Feig sind immer die anderen

Feigheit: Mit diesem Urteil ist man schnell zur Hand. Politiker, Entscheidungsträger aller Art gelten als „feig“, wenn sie das vom Kritiker für notwendig Erachtete nicht angehen. Aber auch im privaten Bereich heißt es oft, dieser oder jene sei zu „feig“ gewesen, einen bestimmten Schritt im Leben zu setzen.
Die aus vielen aufsehenerregenden Kriminalfällen bekannte forensische Psychiaterin Heidi Kastner hat dem Thema einen ausführlichen Essay gewidmet, in dem sie das Phänomen von verschiedensten Seiten beleuchtet.
Was ist das eigentlich, Feigheit? Interessant schon der etymologische Einstieg: „feige“ bedeutete ursprünglich „dem Tod geweiht“. Später wurde dann ein Verhalten angesichts einer vermeintlich oder tatsächlich ausweglosen Lage als „feig“ bezeichnet: vor dem Tod oder einer Gefahr zurückschreckend.
Feigheit und Mut erweisen sich naturgemäß in Extremsituationen. Wir kennen die Debatten über Mitläufer versus Dissidenten. Aber schon Viktor Frankl wies darauf hin, dass man Heroismus nur von einem einzigen Menschen verlangen könne – von sich selbst. Doch nicht nur für totalitäre Systeme gilt: Recht und Gerechtigkeit „müssen immer wieder eingefordert, neu verhandelt und aufs Neue erkämpft werden“, wie Kastner schreibt.
Sie plädiert für den Mut, „moralisch-ethische Normen zu etablieren, sie vorzuleben und damit auch die Feigheit zu definieren: als mangelnde Bereitschaft, sich den Herausforderungen auf allen Ebenen zu stellen“. Wichtig wäre dabei nur die Einsicht, dass die Feigen nicht immer die anderen sind, während man den Mut für sich selbst behauptet.
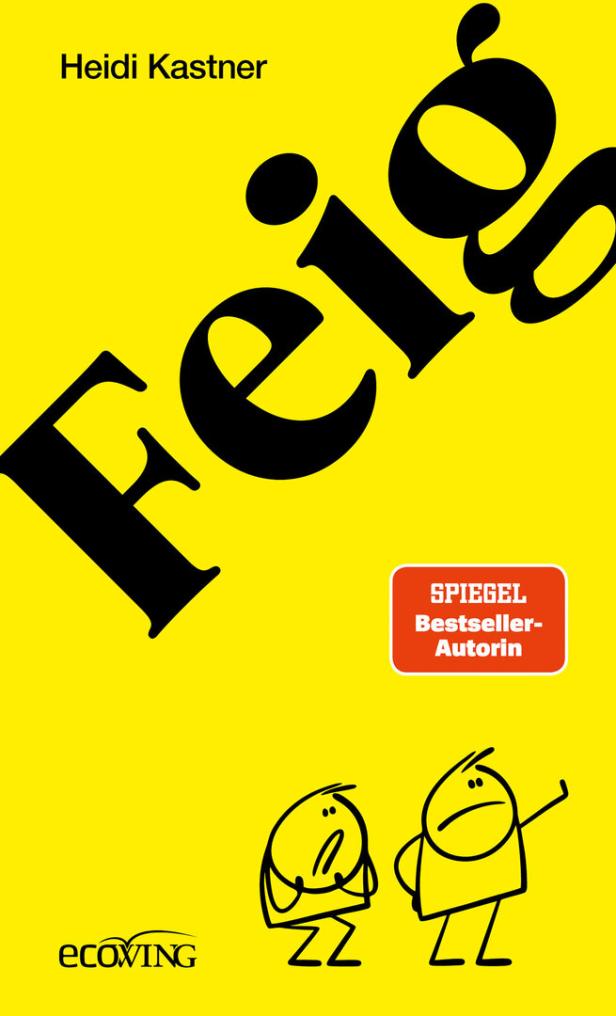
Heidi Kastner: „Feigheit“, Ecowing, 128 Seiten, 20 Euro
Kommentare