Annie Ernaux: Eine Suada des Selbsthasses

Das Debüt der Nobelpreisträgerin, nun zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen, gibt bereits künftige Themen vor: Ausgrenzung der Arbeiterklasse, schwierige Identitätssuche einer jungen Frau, die den Bildungsaufstieg schafft, aber ihre soziale Herkunft nicht hinter sich lassen kann.
September 1973: Allein und unter Schmerzen blickt die zwanzigjährige Studentin Denise Lesur nach einer Abtreibung bei einer Engelmacherin auf ihr bisheriges Leben. Dass sie es zur Studentin gebracht hat, ist ein Wunder. Sie stammt aus einem bildungsfernen Milieu.
Ihre Eltern haben eine Schankwirtschaft, in der Denise zwischen Alkoholikern aufwächst. Dennoch tun sie alles, um dem Kind Bildung zu ermöglichen. Denise ergreift die Chance, wird Vorzugsschülerin, schafft es auf die Universität. Ihre „Unterschichteltern“ sind ihr peinlich – fast so sehr, wie sie sich selbst. Umso mehr, als sie einen jungen Mann aus sogenanntem gutem Hause kennenlernt. Wie bereits im erfolgreich verfilmten Roman „Das Ereignis“ beschreibt Ernaux den Konflikt einer Studentin aus bescheidenen Verhältnissen, die weiß, dass eine Schwangerschaft die Hoffnung, dem prekären Milieu der Eltern zu entkommen, beenden würde.
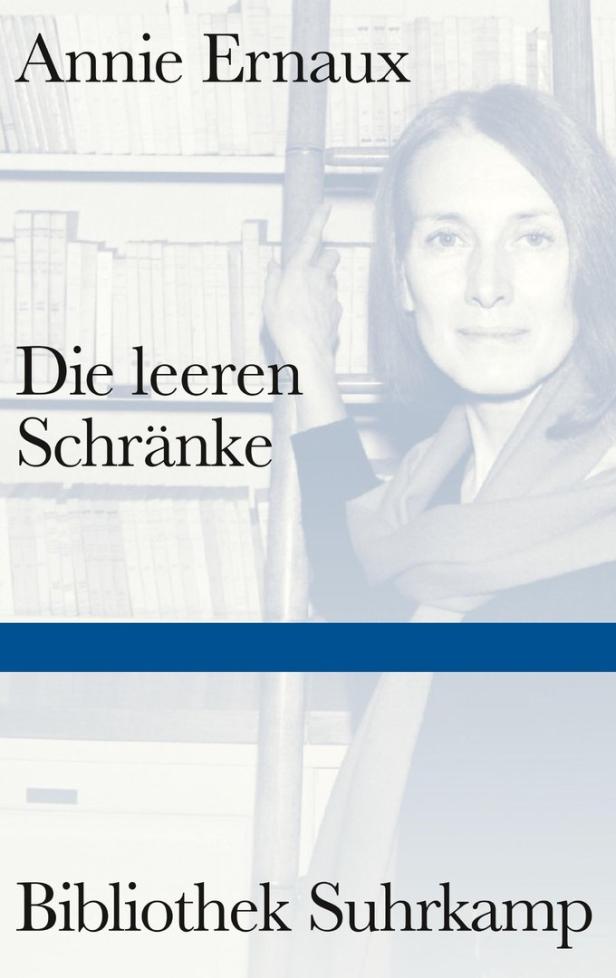
Annie Ernaux:
„Die leeren Schränke“.
Übersetzt von Sonja Finck.
Suhrkamp.
218 S. 23,70€
In der wütend-vulgären Selbstanklage ihres Romandebüts hat sich Ernaux’ klare, sparsame Sprache, die man aus späteren Büchern kennt, noch nicht durchgesetzt. Für Ernaux-Fans aber unverzichtbar.
