Die Arbeitslast drückt auf die Psyche
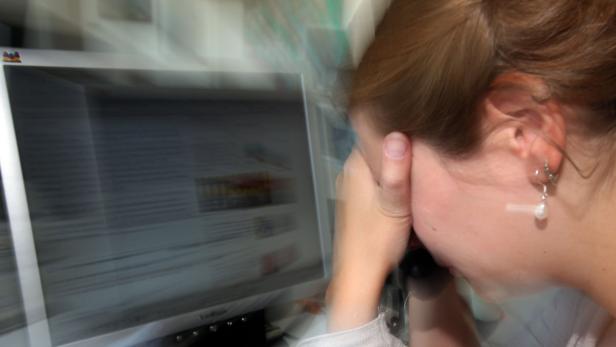
Der Trend ist eindeutig: 1991 arbeitete knapp die Hälfte der Beschäftigten in der EU zumindest ein Viertel ihrer Arbeitszeit unter Termindruck. 2010 waren es bereits mehr als 60 Prozent. "Diese Arbeitsintensivierung hat in den 90er-Jahren deutlich zugenommen", sagt der Arbeitspsychologe Univ.-Prof. Christian Korunka von der Uni Wien. Kurzfristig führe das zum "Kick" eines sehr schnellen Rhythmus, zu einem Gefühl der Leistungsfähigkeit und zum Erleben von mehr Kompetenz. Langfristig hingegen könne es zu Gereiztheit, Nervosität bis hin zur emotionalen Erschöpfung kommen.
Vorbeugen
"Es gibt ein großes Nichtwissen um die eigenen Grenzen", sagt Ulla Konrad, Präsidentin des Berufsverbands der PsychologInnen. Freizeit und Beruf verschwimmen, eine Grenze zu ziehen falle immer schwerer. Betroffen seien vor allem jene, die keine oder wenig Gestaltungsmöglichkeiten haben. "Auch der persönliche Handlungsspielraum ist ein Faktor für die psychische Gesundheit."
Gefordert sei jeder, auch die Unternehmen. "Sie müssen umdenken und sich aktiv damit auseinandersetzen, wo die Mitarbeiter gefährdet sein könnten. Frühzeitige Prävention – etwa durch psychologische Beratung – könne unterstützend wirken und Behandlungskosten sparen helfen. Viel zu oft werden psychische Erkrankungen als eingebildete Probleme verunglimpft. "Faktum ist, dass diese heute besser erkannt und diagnostiziert werden", sagt Konrad.
Bis zu 400.000 psychisch Kranke wären zu einer psychotherapeutischen Behandlung bereit und würden davon auch profitieren, so Eva Mückstein, Präsidentin des Österr. Bundesverbandes für Psychotherapie. "Aber nur 35.000 sind in kassenfinanzierter psychotherapeutischer Behandlung." Weitere 30.000 erhalten einen Zuschuss, müssen aber 60 bis 70 Euro pro Behandlung privat zahlen.
Georg Psota, Chefarzt des Psychosozialen Dienstes in Wien: "Wir müssen die immer noch bestehenden Vorbehalte gegenüber allen psychischen Krankheiten abbauen. "Man darf bei uns alles haben, nur psychisch krank darf man nicht sein." Psychische Erkrankungen seien nichts grundsätzlich anderes als körperliche Erkrankungen: "Beides ist ein Teil des Menschseins." Nicht jede berufliche Überlastung führe zu einer psychischen Erkrankung. "Man darf nicht alles pathologisieren." Umgekehrt stehe hinter einem Burn-out im Endstadium in der Regel eine schwere Depression.
Prävention schon in Volksschule
Schon in der Volksschule kann die psychische Gesundheit gefördert werden. "Zu erkennen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe, ist bereits bei Kindern hilfreich", sagt Psychologenpräsidentin Ulla Konrad. Leicht umsetzbare Zugänge über Bewegung, Ruhe oder Entspannungsübungen wirken sich positiv aus.
In drei Grazer Volksschulen konnte dies im Rahmen des Projekts "Schule und Psyche" (gefördert vom Fonds Gesundes Österreich) bestätigt werden. Seit 2009 gibt es regelmäßig psychologische Beratung für Lehrer und Eltern. Den Kindern werden Strategien zur Konfliktlösung vermittelt. "Es ist ein völlig anderes Bewusstsein entstanden, mit sogenannten Befindlichkeiten umzugehen", sagt Josef Zollneritsch, einer der Verantwortlichen beim steirischen Landesschulrat. Oft machten "scheinbare Kleinigkeiten" – etwa zu wenig Kommunikation – die größten Probleme. "Alle haben durch das Projekt gelernt, dass frühe und niederschwellige Unterstützung in Anspruch zu nehmen die richtige Prävention ist."
Kommentare