Wachsender Fleischkonsum: Antibiotika nehmen zu

Bis 2030 werden weltweit um zwei Drittel mehr Antibiotika in der Nutztierhaltung verwendet als 2010, prognostizieren Forscher im Fachjournal "PNAS". Daran seien wachsender Fleischkonsum und intensivere Viehhaltung in Schwellenländern schuld. In Österreich geht der Antibiotikagebrauch aber beständig zurück, so Michael Hess von der Veterinärmedizinischen Universität Wien im Gespräch mit der APA.
Antibiotika werden in der modernen Viehzucht verbreitet eingesetzt, um die Tiere gesund zu halten und damit sie schneller wachsen. Experten schätzen, dass dafür etwa die doppelte Menge an Antibiotika verbraucht wird wie in der Humanmedizin. In einer Studie mit Daten unter anderem aus Österreich zeigten Forscher in der Fachzeitschrift "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" vor kurzem, dass Schweine, Geflügel und Rinder umso öfter resistente Bakterien tragen, je mehr Antibiotika man verwendet. Diese Antibiotika-Resistenzen können auch an Krankheitserreger bei Menschen weitergeben werden.
Erhöhter Fleischkonsum
Wenn sich die Rahmenbedingungen weltweit nicht ändern, wird der Antibiotikaverbrauch in der Tierhaltung von weltweit 63.000 Tonnen (im Jahr 2010) bis 2030 um 67 Prozent auf 105.000 Tonnen steigen, wie ein internationales Forscherteam nun in einer Studie berechnete, die in der Fachzeitschrift "PNAS" veröffentlicht wurde. Zwei Drittel dieser Steigerung führen sie auf einen erhöhten Fleischbedarf vor allem in Schwellenländern zurück, wodurch mehr Tiere gehalten werden müssen. Das restliche Drittel sei einem Wechsel zu intensiverer Viehzucht in Ländern wie Brasilien, Indien, China, Russland und Südafrika geschuldet. In diesen Ländern erwarten sie sogar eine Verdoppelung der verabreichten Antibiotikamengen.
Laut einem Bericht der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) werden in Österreich und den meisten anderen EU-Ländern dagegen immer geringere Antibiotika-Mengen in der Viehzucht verwendet. Hierzulande sank der Gebrauch von 2010 bis 2012 um 13 Prozent. "Ich glaube, dass dies ein haltbarer Trend ist", sagte Hess, der die Universitätsklinik für Nutztiere und öffentliches Gesundheitswesen an der Veterinärmedizinischen Uni leitet. Es stehe auch außer Frage, dass man in Europa mit Antibiotika gewissenhafter umgehe als in Schwellenländern.
Österreich
Österreich habe in manchen Bereichen eine Vorreiterrolle. "Es ist zum Beispiel das einzige Land in der EU, wo es im Geflügelbereich eine geschlossene Datenbank gibt und bei jedem Bestand genau Bescheid besteht, wie viele Antibiotika verwendet werden", sagte er. Entgegen den medial verbreiteten Aussagen eines Wiener Humanmediziners würden beim Geflügel hierzulande auch keine Chinolone zur Salmonellen-Vorbeugung eingesetzt.
Förderlich für diesen positiven Trend sei auch der Druck durch NGOs und Verbraucher gegen die freizügige Verwendung von Antibiotika in der Tierzucht, meint Hess. "Man wird sie zwar immer brauchen, um kranke Tiere zu behandeln, aber in Zukunft noch mehr Augenmerk auf Prophylaxe und Hygienemaßnahmen legen müssen, als es ohnehin schon geschieht", sagte er. Und um einfach nur das Wachstum der Tiere zu beschleunigen, wie es anderenorts gebräuchlich ist, sei die Verwendung von Antibiotika in Österreich ohnehin schon seit Anfang 2006 verboten.
Die
WHO warnte kürzlich davor, dass immer mehr
Antibiotika unwirksam werden. Wie ernst ist das Problem?
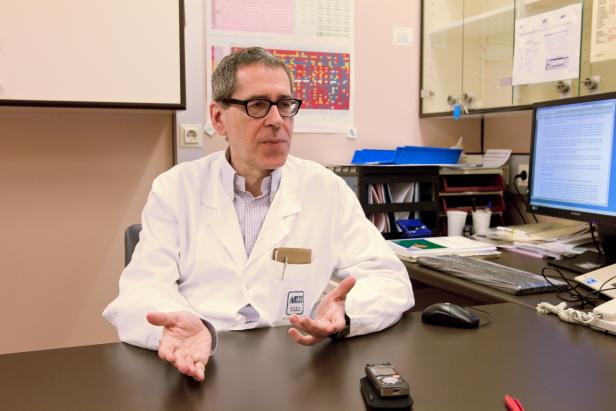
Wie können
Resistenzen verringert werden?
Antibiotika sollten so wenig und so kurz wie möglich verabreicht werden. Viele gehen zum Arzt und verlangen ein Antibiotikum, wenn sie es bei dem einen nicht bekommen, gehen sie zum nächsten. Hier braucht es ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass Antibiotika nur bei bakteriellen, nicht aber bei viralen Infekten wie bei grippalen Infekten helfen. Auch im niedergelassenen Bereich und in Spitälern ist ein verantwortungsvoller Umgang notwendig. Antibiotika-Vorsorge betrifft alle - Bevölkerung, Ärzte, Krankenkassen, Apotheken und Pflege.
In den letzten Jahren sind Neuzulassungen von
Antibiotika deutlich zurückgegangen. Substanzen mit neuem Wirkmechanismus gab es in 30 Jahren nur zwei. Warum?
Die Suche nach neuen Antibiotika ist vergleichbar mit der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Viele haben die Lust verloren, danach zu suchen. Antibiotika sind meist keine Cash Cows – viele der großen Pharmafirmen haben sich aus der Antibiotika-Forschung verabschiedet. Sicherlich aus Kostengründen, denn wenn ein neues Antibiotikum auf den Markt kommt, dann wird es nicht gleich breit eingesetzt, sondern man sperrt es faktisch in den Panzerschrank, um Resistenzentstehung zu verhindern. Hier müssten Anreize geschaffen werden – auch von staatlicher Seite - , dass Pharmafirmen Antibiotika wieder entwickeln, etwa indem die Zulassung vereinfacht wird.
Wie kann man sich die Suche nach neuen
Antibiotika vorstellen? Woran forschen Sie?
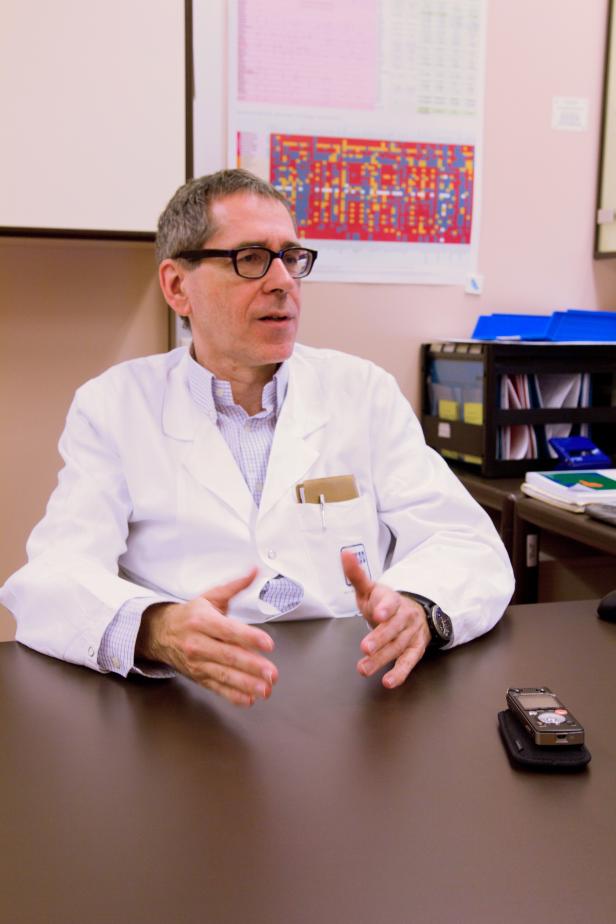
Wonach genau wird gesucht?
Im Meer gibt es viele Bereiche, wo ein Wettkampf stattfindet. Pflanzen und viele Tiere produzieren Abwehrstoffe, wenn sie angegriffen werden und unter Stress stehen. Diese chemischen Stoffe gilt es zu entdecken.
Sie haben schon einige Substanzen aus dem Meer patentieren lassen. Wie ist der aktuelle Stand?
Derzeit finden präklinische Studien statt. Wir haben Substanzen gefunden, bei denen wir antibakterielle Wirksamkeit nachweisen konnten. Jetzt werden diese Substanzen so verändert, dass sie auch verabreicht werden können. Wenn diese Untersuchungen fertig sind, dann sollten die ersten Versuche am Menschen stattfinden. Bis sie als Medikament zugelassen sind, kann es aber noch einige Jahre dauern.
In welchen Bereichen wird derzeit noch nach
Antibiotika gesucht?
Eine Forschungsrichtung sind etwa neue Beta-Lactamase-Hemmer, das sind jene Substanzen, die von Bakterien produziert werden, um die Antibiotika zu zerstören. Man versucht also Kombinationen zu entwickeln, um die mikrobiologischen Resistenzmechanismen zu umgehen. Viel geforscht wird auch an Pflanzen, etwa im Amazonas, wo es genug gibt, die man noch nicht kennt. Es ist aber absehbar, dass in den nächsten Jahren nicht das neue Super-Antibiotikum kommen wird. Um nicht in eine Post-Antibiotika-Ära zu kommen, braucht es also wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Schritte.
Die Suche nach neuen Antibiotika ist wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen: In den vergangenen 30 Jahren wurden nur drei Substanzen mit neuem Wirkmechanismus zugelassen. Umso erfreulicher scheint, dass Forscher aus den USA, Großbritannien und Deutschland nun ein neuartiges Antibiotikum gefunden haben.
Auf solche Entdeckungen ist die Medizin angewiesen, wie Studienautorin Tanja Schneider erklärt: "Wir könnten in eine Vor-Antibiotika-Ära zurückfallen, in der ohne neue Wirkstoffe bakterielle Infektionen nicht behandelbar sind. Die Resistenzen entwickeln sich deutlich schneller, als neue Antibiotika auf den Markt kommen."
"Teixobactin", wie die Wissenschaftler die Substanz in ihrem Artikel in der renommierten Zeitschrift Nature bezeichnen, wirkt ersten Tests zufolge gegen ein breites Spektrum von Krankheitserregern. Vor allem sei die Substanz gegen das resistente Bakterium Staphylococcus aureus wirksam, zu dem auch der als Krankenhauskeim bekannt gewordene MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) gehört. Das teilte die an der Untersuchung beteiligte Uniklinik Bonn mit. Das neue Antibiotikum soll Abhilfe verschaffen.
Gegen resistente Keime
Die Substanz stammt aus dem Erdreich. Dass diese gegen MRSA wirke, sei ein Erfolg, so die Autoren, da der Keim mittlerweile gegen große Gruppen von Antibiotika resistent ist. Pro Jahr sterben Schätzungen zufolge rund 25.000 Menschen weltweit an einer MRSA-Infektion.
Sie kann symptomlos verlaufen, aber auch Hautentzündungen bis hin zu lebensgefährlichen Lungenentzündungen verursachen. Laut dem österreichischen Resistenzbericht AURES lag die MRSA-Rate im Jahr 2013 bei 9,1 Prozent – das bedeutet, rund jeder zehnte infizierte Patient hatte einen resistenten Keim im Blut.
"In Österreich und Europa sind MRSA derzeit sehr selten. Das ist aber regional unterschiedlich. Das neue Antibiotikum ist deshalb interessant. Insbesondere, wie der Wirkstoff gewonnen wurde", sagt Univ.-Prof. Heinz Burgmann, Infektiologe am AKH Wien.
Neues Verfahren
Die Forschergruppe der Northeastern University Boston isolierte das Bakterium mit einem speziellen Kultivierungsverfahren namens iChip. Die Methode ermöglicht, die Zellen der Mikroben zu analysieren, ohne sie aus ihrem natürlichen Umfeld zu entreißen. Auf diese Weise untersuchten die Wissenschaftler rund 10.000 Bakterienstämme.
Das besondere an Teixobactin: Es hemmt den Aufbau der Bakterienwand an mehreren Angriffspunkten – das Bakterium löst sich auf und stirbt. Auch andere Antibiotika, etwa Vancomycin, verhindern den Aufbau der Bakterienwand, allerdings meist an einem Angriffspunkt, nicht an mehreren. Burgmann: "Es gibt aber noch viele Fragezeichen zu Teixobactin. Etwa, ob das Antibiotikum für den Menschen überhaupt geeignet ist, sowie ob und wie man es in großen Mengen herstellen kann."
Mehr Tests notwendig
Erste Versuche mit Mäusen verliefen vielversprechend. Die Verträglichkeit und Wirksamkeit der Substanz für den Menschen müsse noch getestet werden. Dies könne laut Burgmann mehrere Jahre dauern. Auch, wenn Zulassungsverfahren in Europa und den USA aufgrund zunehmender Resistenzen in den vergangenen Jahren beschleunigt wurden.
Für die Annahme, dass gegen Teixobactin tatsächlich keine Resistenzen bestehen, ist es für Burgmann zu früh. "Die Art und Weise, wie die Substanz entdeckt wurde, ist tatsächlich neu. Die Entwicklung des Antibiotikums für den Einsatz bei Patienten steht aber noch am Anfang", meint Burgmann, der auch selbst an der Entwicklung neuer Substanzen forscht.
Der Infektiologe sieht ein größeres Problem im Bereich der sogenannten gram-negativen Bakterien, zu denen etwa E. Coli zählen. "Bei dieser Bakterienart haben wir in der Entwicklung ein großes Loch. In Österreich sind z. B. schon 20 Prozent der E.-coli-Stämme gegen früher wirksame Antibiotika resistent."
Kommentare