E-Wirtschaft ächzt unter tiefen Strompreisen

Die heimische E-Wirtschaft stöhnt unter den tiefen Strompreisen im Großhandel und sieht weitere Kraftwerksinvestitionen gefährdet. Nicht einmal neue Wasserkraftanlagen würden sich heute rechnen, sondern nur geförderte Ökostrom-Erzeugung, kritisiert Oesterreichs-Energie-Präsident Wolfgang Anzengruber.
In der E-Control hält man längerfristig niedrige Notierungen für möglich, auch weitere Rückgänge. "Meine Prognose wäre: Die Großhandelspreise werden noch weiter sinken - jedenfalls sehr niedrig bleiben", meinte Johannes Mayer von der Abteilung Volkswirtschaft des Regulators, am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion. Wenn dann Strom zeitweise gar nichts koste, öfter als jetzt, dann könnte die Politik im Hinblick auf das Erreichen von Effizienzzielen womöglich auf die Idee kommen, dass sie die Kilowattstunde mit Steuern und Abgaben belege anstelle des Preises, denn der könnte gelegentlich "Null" sein.
Er rechne künftig mit sehr niedrigen Energiepreisen über den Großteil des Jahres, sagte der E-Control-Experte. Die Branche werde dann freilich "ein großes kommunikatives Problem bekommen", die Preise für die Haushaltskunden zu rechtfertigen. Als Haushaltsausgaben-Komponente dürfe sich Strom nicht verteuern, gestand Anzengruber zu, er dürfe kein "Luxusgut" werden.
"Strom will jeder haben, aber die Produktion und der Transport wird gehasst."
In einer funktionierenden Marktwirtschaft dürfte es eigentlich gar keine negativen Preise geben, betonte Anzengruber beim Trendforum des Interessenverbandes der E-Wirtschaft. Dass das an den Strombörsen speziell bei Wind- oder Solarstromüberschuss und wenig Verbrauch aber doch immer wieder der Fall ist, zeige, dass es sich um einen verzerrten, imperfekten Markt handle. Ja, die Erneuerbaren seien falsch reguliert, räumte Mayer ein und meinte, angesichts der Marktsituation "könnte Stromverbrauch ein gutes Geschäft sein", wenn man zu bestimmten Zeiten nämlich Geld für den Konsum von Elektrizität bekomme. Industriebetriebe und auch EVU könnten damit vielleicht gute Geschäfte machen - erste Pools, sogenannte "virtuelle Kraftwerke", formieren sich ja bereits.

"Dann investieren nur Idioten"
Wenn Strom aus neuen Kraftwerken 50 Euro die Megawattstunde (MWh) koste, im Großhandel aber nur zu 33 oder 34 Euro je MWh abgesetzt werden könne, "wird niemand mehr investieren", warnte Anzengruber - "das machen ja nur Idioten". Die CO2-Preise seien zu niedrig, um die schmutzigen Braunkohle- und danach auch die Steinkohlekraftwerke vom Netz zu bringen. "Wir hatten schon 30 Euro pro Tonne CO2, derzeit kostet die Tonne 6,50 bis 6,80 Euro." Dies führe dazu dass sich etwa eine Tonne Zement, bei deren Produktion 500 Kilogramm CO2 anfallen würden, nur um drei, vier Euro verteuere. Für eine Tonne Stahl mit 1,5 Tonnen CO2-Emission betrage die Belastung lediglich 9 bis 10 Euro.
Wunschzettel an die Politik
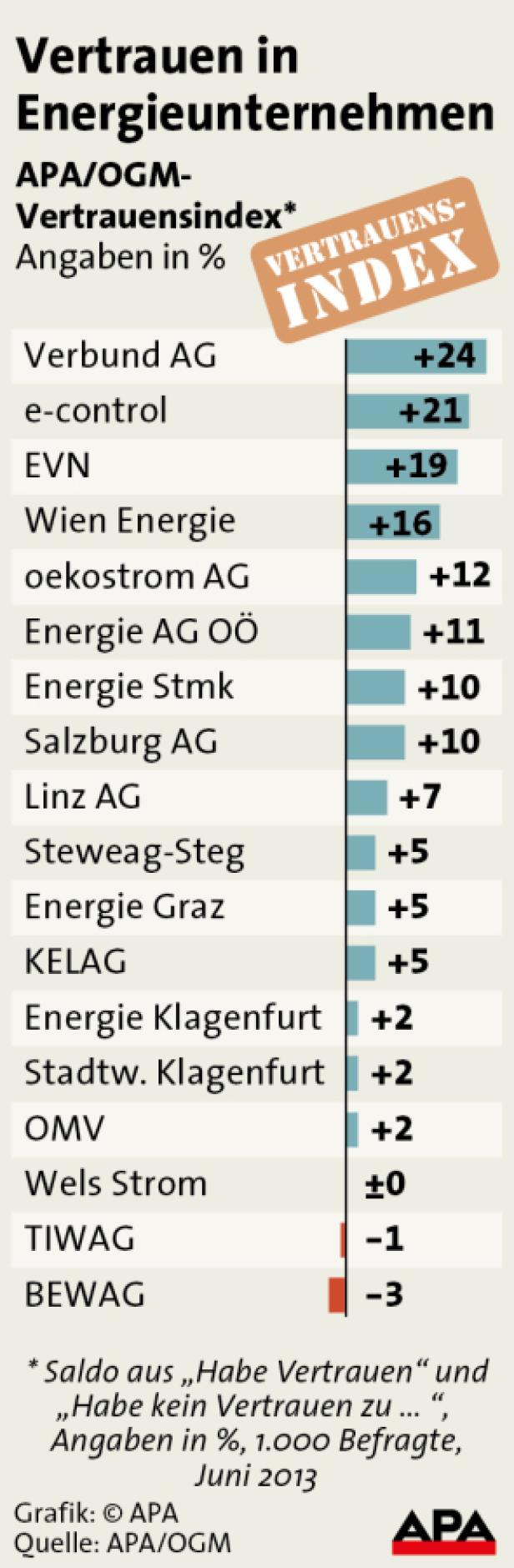
Gegenüber 2007/08 seien die Stromnotierungen um über 50 Prozent gesunken, dadurch entstehe bei den Versorgern "Druck auf die Bilanzen und Erträge".
Angebot-Nachfrage sei aus dem Gleichgewicht, selbst ohne Nachfrage kämen bevorrangt große geförderte Strommengen zu fixen Abnahmepreisen ins Netz. Die Sicherheit der Versorgung, nämlich zu jeder Zeit und in jeder Menge Strom zu bekommen, wie es die EVU gewährleisten würden, sei nicht bepreist, "dafür wird nichts bezahlt".
Regulierungskosten seien zu hoch
Kritisiert wurde beim Trendforum, dass Ökostrom nur elf Prozent der heimischen Erzeugung stelle, aber angesichts des Förderaufwands von 657 Mio. Euro so viel koste wie ein Viertel des Marktwerts der Gesamterzeugung in Österreich. Durch die gefallenen Stromnotierungen sei der Marktwert der im Inland produzierten Elektrizität von 2011 bis 2014 von 4,7 auf 2,7 Mrd. Euro gesunken, zugleich aber der Anteil der Regulierungskosten daran von 9 auf 16 Prozent gestiegen.
In ihrer Rechnung kommt Oesterreichs Energie auf 461 Mio. Euro Kosten der Regulierung für die E-Wirtschaft.
Was der Staat dabei verdient
Die öffentliche Hand nehmen laut Interessenverband aktuell jährlich 4,15 Mrd. Euro durch die Aktivitäten der E-Wirtschaft ein - und zwar 2,15 Mrd. aus den Abgaben und Steuern auf Elektrizität, weitere 1,5 Mrd. Euro an Steuern aus der Tätigkeit der Unternehmen sowie rund 500 Mio. aus Dividendenzahlungen.
Kommentare