PISA-Studie kommt am 3. Dezember
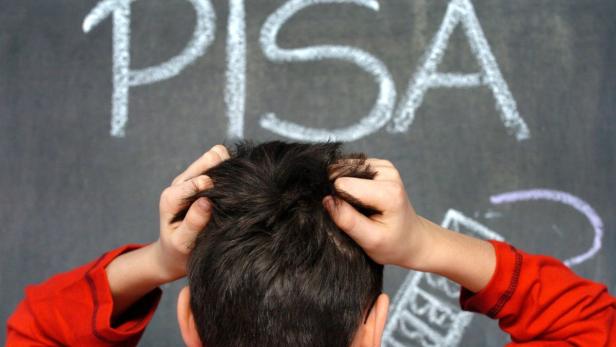
Lehrerdienstrecht, Lehrer-Protest, PISA-Studie: Zurzeit gibt es in der Bildungsdebatte viele Reizwörter. Die neue PISA-Studie wird nun am 3. Dezember veröffentlicht. International verglichen werden dabei wie immer die Kompetenzen der 15- bis 16-jährigen Schüler beim Lesen, der Mathematik und in den Naturwissenschaften. Dem Vernehmen nach sind die Ergebnisse heuer für Österreich besser ausgefallen als 2010.
Beim bisher letzten PISA-Durchlauf im Jahr 2009, dessen Ergebnisse 2010 präsentiert wurden, war Lesen das Schwerpunkt-Thema: Ausgerechnet in dieser Disziplin erreichte Österreich damals eines der schwächsten Ergebnisse der 65 Teilnehmerländer, nur die Türkei, Chile und Mexiko schnitten schlechter ab. Schon bei den vorherigen PISA-Studien war Österreich beim Lesen immer signifikant unter dem OECD-Schnitt gelegen.
In der Mathematik, die bei PISA 2012 Schwerpunkt-Bereich war, landeten Österreichs Schüler 2009 im Durchschnitt der übrigen untersuchten Länder. In den Naturwissenschaften verschlechterten sie sich im Vergleich zu PISA 2006 von einem Ergebnis signifikant über dem OECD-Schnitt auf eines signifikant darunter.
Einschränkung dabei: Aufgrund eines Boykott-Aufrufs von Schülervertretern in der ersten Testphase veröffentlichte die OECD die Österreich-Ergebnisse 2010 nur "mit Vorbehalt" und sah deshalb von Vergleichen mit den früheren PISA-Tests ab. Aus diesem Grund könnte die OECD auch heuer auf einen direkten Vergleich mit dem Jahr 2009 verzichten.
"Risikoschüler"
Weitere Resultate 2009: Die Zahl der "Risikoschüler" war stark angestiegen. 28 Prozent der 15- bzw. 16-Jährigen konnten nicht sinnerfassend lesen, unter den Burschen lag der Anteil sogar bei 35 Prozent (Mädchen: 20 Prozent). In der Mathematik hatten 23 Prozent der österreichischen Jugendlichen sehr geringe Kompetenzen, in den Naturwissenschaften 21 Prozent. Insgesamt hatte mehr als ein Drittel der Schüler (34 Prozent) in zumindest einem Kompetenzbereich massive Defizite, acht Prozent hatten in zwei Bereichen nicht einmal Basiskenntnisse, 15 Prozent in allen drei.
2012 dürften die Leistungen der Schüler besser gewesen sein: Das erfuhr die APA inoffiziell von mehreren Seiten. Indiz dafür auch: Die scheidende Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) hat schon angekündigt, die Studie noch selbst vorstellen zu wollen.
Für die aktuelle, fünfte Ausgabe von PISA wurden 2012 in 66 Ländern (darunter alle 34 OECD-Staaten) rund 500.000 Schüler des Jahrgangs 1996 in den Disziplinen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften und (erstmals wieder seit 2003) Problemlösen getestet. In Österreich wurde dafür eine Zufallsstichprobe von rund 5.000 Jugendlichen in 200 Schulen untersucht. Durchgeführt wird die Studie hierzulande vom Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) im Auftrag des Unterrichtsministeriums.
Die OECD-Studie PISA (Programme for International Student Assessment) ist der größte internationale Schüler-Leistungstest. Dabei wird ein Spektrum jener Fähigkeiten erfasst, "die zur Bewältigung von vielfältigen Aufgaben nötig sind und mit denen jede Person einmal konfrontiert werden könnte". Die Aussagekraft über das Wissen der 15-Jährigen ist aber laut Bildungswissenschaftern eingeschränkt.
Darunter ist mit Josef Lucyshyn einer der früheren Direktoren des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie), das in Österreich für die Bildungsvergleichsstudie zuständig ist. Seine Begründung: Bei PISA werde ein "Katalog von Weltwissen" abgefragt, der von Experten erstellt und bei dem nationale Lehrpläne sowie die kulturellen Hintergründe von Bildung und Schule ignoriert werden. "Man kann nur sagen: Im Vergleich mit anderen Ländern schneiden wir so ab", sagte er in einem Interview anlässlich zehn Jahre PISA. Dazu kämen große Unterschiede etwa bei der Organisation von Österreichs Schulwesen im Vergleich zu anderen Ländern, die nicht berücksichtigt werden. Hintergründe für das Leistungsniveau der Schüler kann PISA laut der ehemaligen Studienleiterin Claudia Schreiner ebenso wenig liefern wie Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungen.
"Politischer Zweck"
Schon rein technisch sei es nicht möglich, aus den PISA-Ergebnissen etwas über die Qualität der Schule, der Länder oder der Lehrerausbildung herauszulesen, betonte in der Vergangenheit auch Stefan Hopmann, Professor für vergleichende Bildungsforschung an der Uni Wien und Mitherausgeber eines 2007 erschienenen Sammelbands mit kritischen Beiträgen zu PISA. Jener Teil von Wissen, der unabhängig von Sprache, Schulsystemen und Lehrplänen verglichen werden könne, sei winzig. Nicht einmal darüber, wie viele Risikoschüler mit ganz schlechten Kenntnissen es gibt, kann PISA laut Hopmann etwas aussagen. Die Daten würden nämlich nachträglich so normalisiert, dass immer ein bestimmter Teil in der Risikoabteilung landet. "Sonst würde PISA nicht seinen politischen Zweck erfüllen, das sollen ja Horrormeldungen sein."
Kommentare