Brandstätters Blick: Der freie Wille – und seine Grenzen

„Ja, ich will“, sagen die Hochzeiter, gefragt, ob sie „nach reiflicher Überlegung und freiem Entschluss den Bund der Ehe schließen wollen“. Ein ehrliches Ja kann es nur geben, wenn wir Menschen wirklich über einen freien Willen verfügen. Aber tun wir das?
Wir müssen an den freien Willen glauben, weil das Strafrecht mit der persönlichen Verantwortlichkeit sonst keinen Sinn machen würde, weil jegliches Zusammenleben bedroht wäre, wenn jede Handlung durch unbewusstes Agieren entschuldbar würde. Dennoch: Immer mehr Versuche von Psychologen weisen nach, dass unser Handeln allzu oft nicht das Ergebnis eines Nachdenkprozesses ist, sondern eine Summe von Abläufen, die gar nichts mit logischen und vernunftbetonten Vorgängen im Gehirn zu tun haben, auf die wir so stolz sind.
Der amerikanische Psychologe John Bargh hat die wichtigsten und aufschlussreichsten Experimente der vergangenen Jahrzehnte in einem Buch zusammengefasst. Und zwingt uns damit zum Nachdenken darüber, welche der täglichen Entscheidungen wirklich auf unserem freien Willen beruhen, und wo wir ständig Opfer von alten Mustern oder auch bewussten Manipulationen, etwa von Werbung oder politischer Propaganda, werden.
„Sie haben einen freien Willen“, teilt John Bargh seinen Lesern mit. Aber, und das ist mindestens so wichtig: „Er ist nicht ganz so frei und so allmächtig, wie Sie vielleicht geglaubt haben.“ Gut, dass jetzt noch ein „Aber“ kommt: Zu akzeptieren, dass unser freier Wille von vielen Faktoren, früheren Erlebnissen, bewussten Täuschungen und äußeren Einflüssen abhängig ist, macht uns freier. Wir können nämlich bewusst darauf achten, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht geplant oder gewollt hatten.
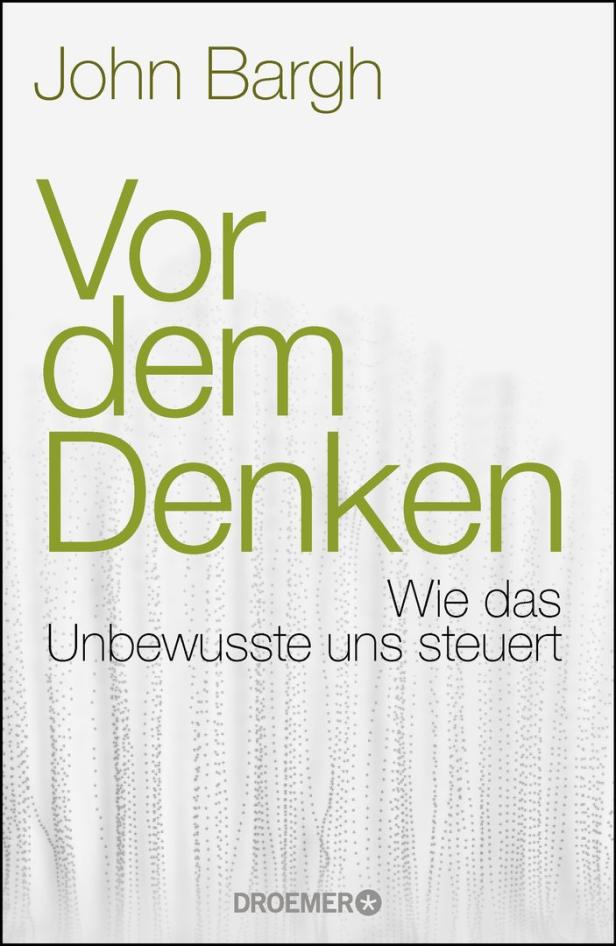
John Bargh, „Vor dem Denken. Wie das Unbewusste uns steuert.“ Droemer Verlagm 464 Seiten, 24,99 €
Die Experimente, die der an der Yale University lehrende Professor selbst gemacht hat oder beschreibt, zeigen uns, wie vielfältig wir gesteuert werden, eben nicht nur durch Denkvorgänge. Schon der amerikanische Autor Ambros Bierce (1842–1914) wusste ja: „Das Gehirn ist das Organ, mit dem wir denken, dass wir denken.“
Das große Unbewusste
Zunächst sind wir in unserem Verhalten ja schon von den Eltern vorgeprägt. Kinder, die eine Bindung zu ihren Eltern entwickeln konnten, gehen später eher ohne Angst durchs Leben. Aber es gibt auch ein Experiment, das zeigt, wie wir von einfachen Umständen des Leben abhängig sind. Jemand, der ein heißes Getränk in der Hand hält, ist eher zu Gedanken für soziale wärme bereit als jemand, der gerade einen Eiskaffee berührt.
Es gibt aber auch viele Experimente, die die Möglichkeiten der Manipulation nachweisen. Mit sogenannten „Priming-Methoden“ kann man die Urteilsbildung von Menschen auf der unbewussten Ebene steuern. Dabei spielen frühere Erfahrungen eine Rolle, momentane Einflüsse, aber auch die vielen Bilder, die wir im Kopf haben, und die oft positiv oder negativ konnotiert sind. Mit einem Film über den Einsatz von Feuerwehrleuten kann man leicht die Vorstellung von Tapferkeit „primen“, also hervorrufen.
Viele unserer Handlungen sind einfach auf die Evolution der Menschen zurückzuführen. Der Homo sapiens hat sich letztlich gegen alle Konkurrenten durchgesetzt, weil er besser kooperieren und gemeinsam handeln konnte. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sicherte das Überleben. Dass wir uns gerade in Krisenzeiten gegen Menschen, die anders aussehen, abgrenzen wollen, ist also erklärbar.
Attraktion und Emotion
Vor allem der Fortpflanzungstrieb sichert das Überleben. Und auch wenn es kein Chef je zugeben würde, sehen sie sich Bewerbungen von in ihren Augen attraktiven Frauen genauer an. Das haben Experimente ergeben. Ebenso wurde nachgewiesen, dass Börsehändler an sonnigen Tagen eher zu Käufen neigen, an trüben zu Verkäufen.
Das Gehirn ist ein extrem kompliziertes Gerät, was auch daran liegt, dass es sich im Laufe der Evolution stark verändert hat. Am Anfang war das sogenannte limbische System, wo auch heute noch zum Teil Bilder gespeichert und Emotionen gesteuert werden. Kein Wunder also, dass mit Bildern Gefühle geweckt werden. Die kommerzielle Werbung nutzt das seit Langem, die politische immer mehr.
In der politischen Propaganda ist entscheidend, dass sich negative Emotionen leichter hervorrufen lassen als positive. Bargh schreibt: „Es ist seit Langem bekannt, dass Menschen konservativer werden und Veränderungen eher ablehnen, wenn sie sich in irgendeiner Weise bedroht fühlen.“ Solche Bedrohungen, ob real oder eingebildet, lassen sich bewusst hervorrufen, durch Bilder in Medien etwa.
Überall auf der Welt arbeiten rechte Parteien verstärkt mit Bedrohungsszenarien, mit starken Bildern wird vor Gefahren gewarnt. Die Herausforderungen durch die Globalisierung werden weiter Angst machen, man kann sie verstärken – oder Lösungen suchen. Das sind politsche Entscheidungen, wir haben den freien Willen, sie zu treffen. Umso leichter, wenn wir uns der Einschränkungen des freien Willens bewusst sind.
Kommentare