Deutsch lernen unter Strafandrohung?
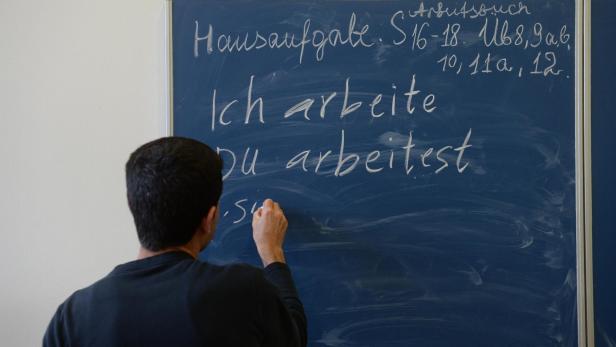
Archivfoto aus Deutschland
Lediglich vier von zehn angetretenen Geflüchteten haben 2024 die verpflichtende Integrationsprüfung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) bestanden. Die Regierung möchte das jetzt ändern – und zwar durch Sanktionen für jene Personen, die binnen drei Jahren nicht ein bestimmtes Sprachniveau (A2) erreichen. Allerdings: Selbst die in der Regel hochgebildeten und damit meist lerngewohnteren ukrainischen Geflüchteten (75 Prozent Hochschulabschlüsse bzw. andere hohe Qualifikationen) schafften zu 30 Prozent die Prüfung nicht.
Gleichzeitig ist aber auch die Gesamtanzahl der Teilnehmenden an den Prüfungen 2024 am 21 Prozent gestiegen. Ein grundsätzliches Motivationsproblem auf Seiten der Lernenden geben die Zahlen somit nicht her. Fakt ist, dass schon jetzt die „Integrationsprüfung“ – also ein punktuelles, streng reguliertes Setting zur Leistungsmessung – vor allem für lern- und prüfungsungewohnte Erwachsene eine große Hürde darstellen kann. Kursteilnehmende, die vor Krieg, Verfolgung und Folter geflüchtet sind, haben zum Teil nicht gleich sichtbare Einschränkungen beim Lernen bzw. in Stresssituationen.

John Evers.
Frusterlebnisse
Weitere zentrale Herausforderungen sind die Zuweisungssysteme und Prüfungsformate. Sprachniveaus werden vor der ersten Kursteilnahme erhoben, verändern sich aber mit jeder Kursteilnahme individuell. Mündliche und schriftliche Sprachkompetenz eines Menschen können weit auseinanderliegen. Nicht selten sitzen so Personen in Kursen mit für sie nur teilweise passenden Niveaustufen – ein systemisch bedingtes Frusterlebnis. Und nicht zuletzt verdrängt ein dermaßen stark intendiertes „training to the test“ häufig auch das sinnerfassende Verstehen und Anwenden der deutschen Sprache.
All diese Faktoren wirken bereits jetzt negativ auf das Kursgeschehen und damit nicht nur auf den individuellen Lernerfolg. Sie belasten auch die umsetzenden Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenbildung. Schon bisher setzte das System übrigens auf Sanktionen. Für Mindestsicherungsbezieher aus Drittstaaten ist z.B. in Wien eine Teilnahme an Deutsch-, Werte- und Orientierungskursen Pflicht. Aber finanzielle Einbußen, nur weil ein Deutschkurs nicht bestanden wurde, eröffnen tatsächlich eine neue Dimension des Strafens.
In der konkreten Umsetzung bleibt Vieles noch vage. Dass Ministerin Claudia Plakolm (ÖVP) aber trotzdem schon einmal Ausnahmen im Einzelfall zusagt, ist zwar für die Betroffenen richtig und wichtig. Gleichzeitig wird wohl auch hier der entsprechende Druck und vor allem auch Aufwand an die Organisationen weitergereicht, die eben tagtäglich mit den Teilnehmenden lernen und arbeiten.
An richtigen Schrauben drehen
Was es angesichts der jüngsten Beschlüsse jedenfalls sofort braucht, sind begleitende Maßnahmen, die tatsächlich positiv auf den Prüfungserfolg von Teilnehmenden in Deutschkursen wirken können. Der individuelle Sprachstand muss vor jedem Deutschkurs differenziert erhoben werden, damit niemand im Kurs mit dem falschen Sprachniveau sitzt. Kursformate müssen in Kooperation mit den Erwachsenenbildung-Einrichtungen bedarfsorientiert weiterentwickelt und aufgesetzt werden (z.B. für Lernungewohnte, für den Fokus Schriftkompetenz …).
Und es braucht Beratungsangebote zur Bearbeitung von im Kursalltag aufkommenden, lernhinderlichen, persönlichen Problemlagen. Begleitend dazu ist eine externe Evaluation der beschlossenen Maßnahmen notwendig. Gerade Prüfungs- bzw. besser Abschlussformate müssten hier weiterentwickelt werden. Und zwar – wie in der Erwachsenenbildung längst üblich – im Sinne einer Steigerung der Selbststeuerung der erwachsenen (!) Lernenden.
Abschließend: Wo immer es bisher eine gesellschaftliche Herausforderung in Bildungsfragen gegeben hat, hat die (gemeinnützige) Erwachsenenbildung geliefert. Besonders gut haben diese Kraftanstrengungen immer dann funktioniert, wenn man mit den Bildungsträgern zuerst geredet und dann gemeinsam treffsichere Lösungen auf den Weg gebracht hat. Im Fall der beschlossenen finanziellen Sanktionen für Deutschlernende hat dieser Dialog allerdings noch nicht stattgefunden.
Zum Autor:
John Evers ist Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen
Kommentare