Nach Rekordstrafe: Der Oberste Gerichtshof in schlechter Verfassung

Sitz des OGH im Wiener Justizpalast: Hat das Höchstgericht Verfassungsrecht ignoriert?
Wann ist eine nationale Kartellstrafe angemessen? Für den OGH offenbar, wenn sie hoch genug ist, um europaweit verhängten Strafen gleichzukommen – Willkür lässt grüßen. Das Höchstgericht hat sich im Fall REWE jedenfalls nicht lumpen lassen und für ein bloßes Formalvergehen ohne tatsächliche Auswirkungen auf den Wettbewerb eine Geldbuße verhängt, die satte 46-mal höher ausfällt als jene des Erstgerichts. Die Begründung? Eine vage Berufung auf die Größenordnung von komplett anders gelagerten EU-Geldstrafen und eine ebenso vage österreichische Rechtsgrundlage. Was daraus folgt, ist ein Urteil, welches zahlreiche verfassungsrechtliche Probleme aufweist. Während sich Bestimmtheitsgebot und Grundrechte dezent die Augen reiben, bleibt eine Frage offen: Gilt künftig die Richtschnur des Rechts oder der Wille der Willkür?
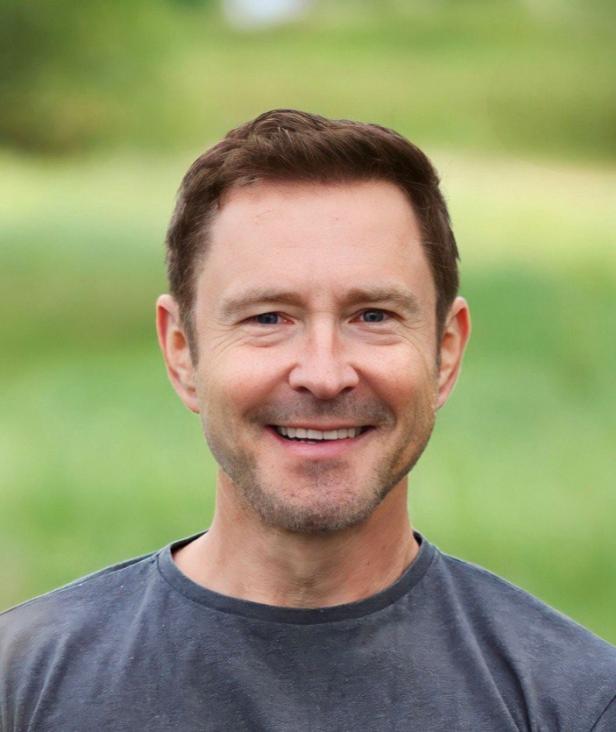
Christian M. Piska
Der Gesetzgeber ist nach der Bundesverfassung verpflichtet, hinreichend bestimmte Gesetze zu erlassen. Gerade bei Strafen ist es besonders wichtig, dass genau geregelt wird, was erlaubt ist und was nicht. Unklare Formulierungen sind dabei laut Europäischer Menschenrechtskonvention (Art 7 EMRK) verboten, eine solche lag jedoch im gegenständlichen Fall vor: So ist ein Zusammenschluss zweier Unternehmen (bei Überschreiten einer gewissen Umsatzgröße) bei der Bundeswettbewerbsbehörde im Vorhinein anzumelden. Ein solcher Zusammenschluss liegt nach der rechtlichen Definition (§ 7 Abs 1 Z 1 KartG) dann vor, wenn ein Unternehmen ein anderes „ganz oder zu einem wesentlichen Teil erwirbt, insbesondere durch Verschmelzung oder Umwandlung.“ Was gilt nun, wenn – wie bspw im Fall REWE – kein Aktivvermögen erworben wurde, sondern ein stillgelegter Betrieb an REWE bloß verpachtet wurde? Liegt in diesem Fall tatsächlich der Erwerb eines Unternehmens vor?
Eine diffizile Frage, welche die Unklarheit der gegenständlichen Bestimmung verdeutlicht. In solchen Fällen unklarer Strafnormen ist – aufgrund der Verfassung – eine zurückhaltende Auslegung geboten. Auch der ehemalige Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Heinz Mayer, sieht in einem Gastbeitrag im Standard, dass der OGH hier die verfassungsrechtlichen Grenzen überschritten hat. Im Ergebnis hat damit der Gesetzgeber durch eine unklare Formulierung des Zusammenschlusstatbestandes den Boden für eine verfassungsrechtlich nicht minder problematische extensive Auslegung durch den OGH geebnet. Ein Höchstgericht hat damit de facto einen Straftatbestand erfunden und gegen den Grundsatz der Gewaltentrennung verstoßen.
4600 Prozent
Auffällig ist, dass der OGH mindestens so viele Strafmilderungsgründe anerkennt wie das erstinstanzliche Kartellgericht, trotzdem jedoch eine Strafe verhängt, welche um circa 4600 Prozent höher ist als von der ersten Instanz angeordnet – ein Pass ins Abseits, der jeden aufmerksamen Leser des Urteils verwundert zurücklässt. So findet sich kaum eine Gewichtung von Erschwernis- und Milderungsgründen und auch eine Erklärung, warum genau ein Betrag von 70 Mio. Euro gewählt wurde, bleibt der OGH schuldig. Mit der gelieferten Begründung ließe sich wohl jede Strafe von 2 bis 70 Mio. Euro rechtfertigen, eine denkbar schlechte Ausgangslage für die Nachvollziehbarkeit des Urteils. Lediglich in den letzten Sätzen der Entscheidung offenbart das Höchstgericht seine wohl dahinter liegende Intention: Eine Anpassung der Strafgrößenordnung an die Unionsebene. Dabei soll offenbar ein Exempel statuiert werden, wofür die Rechtssache REWE völlig ungeeignet ist. Ein Verweis auf europäische Kartellstrafen vermag eine derartige Straferhöhung nicht zu rechtfertigen. Folgen diese doch teils anderen Grundsätzen und sind auf die Sanktionierung von schwerwiegenden grenzüberschreitenden Wettbewerbsverletzungen ausgelegt, von denen hier keine Rede ist. Daher ist dieser Verweis als reine rechtspolitische Wunschvorstellung zu werten, die Willkür bedeutet. Damit verstößt der OGH gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip, gegen das Grundrecht auf ein faires Verfahren nach Art 6 EMRK und gegen den Gleichheitssatz.
Fazit: Wenn Gerichte Rechtspolitik betreiben und Strafen ohne klare Grundlage verhängen, wird aus Recht Unsicherheit – mit weitreichenden Folgen für den Wirtschaftsstandort.
Christian M. Piska ist ao. Universitätsprofessor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien.
Kommentare