Streit um Vermeer wurde persönlich

Es ging um ein Kunstwerk, das Adolf Hitler persönlich ankaufte. Darum, ob der Verkäufer freiwillig oder unter Druck handelte. Und es ging um ein unbezifferbares Vermögen: Die Erben nach Jaromir Czernin argumentierten für eine Rückgabe von Vermeers "Die Malkunst", eines der absoluten Highlights der Sammlung des Kunsthistorischen Museums (KHM).
Die Kommission für Provenienzforschung nahm sich des Falles an. Und beschied 2011, dass eine Rückgabe nicht gerechtfertigt sei. Der Beirat etwa fand "keinen einzigen Hinweis", so hieß es damals, wonach der Verkauf des Gemäldes an Hitler unter Zwang abgeschlossen worden sei. An diesem Punkt enden Kunstrückgabe-Fragen gewöhnlich; tauchen keine neuen Fakten auf, bleiben die Entscheidungen aufrecht.
Nachspiel

Die Klage gegen Hehenberger wurde abgewiesen – sowohl vom Handelsgericht als auch letztinstanzlich vom Oberlandesgericht Wien, und zwar unter Verweis auf die Freiheit der Wissenschaft. Dass in einem Restitutionsfall jedoch die sonst im Hintergrund arbeitenden Forscher persönlich in Rechtsstreits gezogen werden, bezeichnet deren wissenschaftliche Koordinatorin, Rektorin Eva Blimlinger, als "perfide": Die Klage "war der untaugliche Versuch, den Fall wieder aufzumachen", sagt sie zum KURIER. "Man hat hier persönlich auf eine Mitarbeiterin" und damit auf "die schwächste Position" zugegriffen, anstatt gegen die Republik oder den Spruch vorzugehen.
Eine Frage der Ehre
Die Provenienzforscher arbeiten die Geschichte des jeweiligen Raubkunstfalles auf. Sie versuchen zu rekonstruieren, ob ein Werk während der NS-Zeit zu Unrecht in Besitz des Staates gekommen ist; ist dem so, muss dieses zurückgegeben werden. Ergebnis der Forscherarbeit ist ein Dossier, auf dessen Basis der Kunstrückgabebeirat eine Empfehlung abgibt.
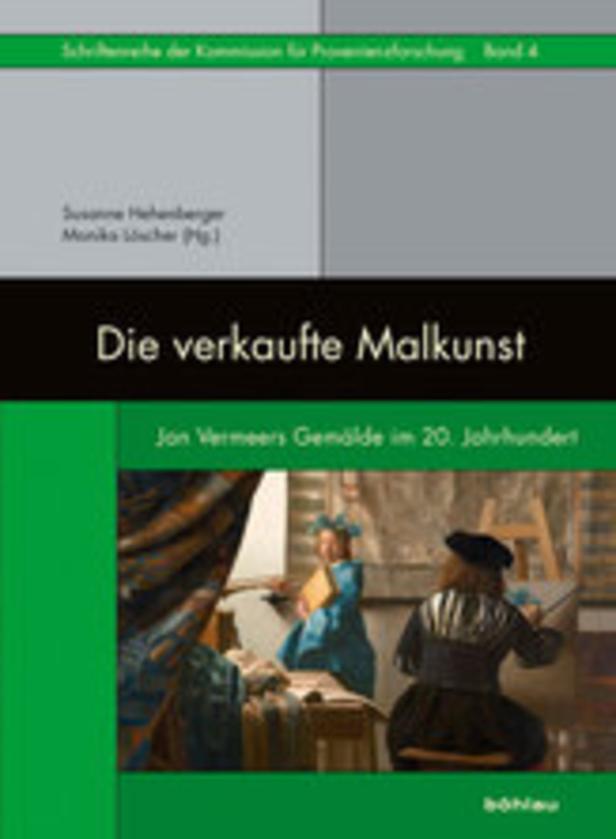
Diese Beurteilung sei "völlig abwegig" und das Lebensbild Czernins "gröbst verzerrend und herabsetzend", hieß es daraufhin in der Klage. Im Restitutionsfall war argumentiert worden, dass Czernin unter Druck gestanden sei, das Bild letztlich für 1,65 Millionen Reichsmark zu verkaufen. Durch die gegenteiligen Behauptungen sei Czernin in seiner Ehre verletzt (ein Umstand, der auch nach dem Tod rechtlich möglich ist). Hehenberger wurde deswegen auf Unterlassung geklagt.
Der Streitwert von 34.000 Euro ist zwar nicht vergleichbar mit den Millionenwerten, um die es bei der "Malkunst" ging. Aber für eine Privatperson dennoch eine respektable Summe. Hehenberger war über die Gewerkschaft rechtschutzversichert. Blimlinger betont, dass die Kommission "vollständigen Schutz" zusagt habe und für Zahlungen auch in etwaigen zukünftigen derartigen Streits aufkommen würde.
Das Urteil sei aber so eindeutig, dass Blimlinger nicht von weiteren Versuchen in anderen Fällen ausgeht.
Schulenstreit
Die Begründung der Urteile fußt nämlich nicht auf Details des Falles, sondern auf verfassungsrechtlichen Feststellungen. Etwa auf einem Spruch des Obersten Gerichtshofs, dass es "nicht die Aufgabe eines Ehrenbeleidigungsprozesses ist, einen in der Fachwelt strittigen ,Schulenstreit‘ zu entscheiden". Es müsse "der Wissenschaft überlassen bleiben, die Richtigkeit der beanstandeten Behauptungen zu beurteilen", beschied auch das Oberlandesgericht Wien, das eine Berufung letztinstanzlich ablehnte.
Der KURIER suchte auch um ein Statement der Klägerin an. Diese will aber derzeit keine Stellungnahme gegenüber Medien abgeben.
Zur Geschichte des Bildes
Das Werk ist zwischen 1666 und 1668 entstanden und das größte der 37 erhaltenen Bilder von Jan Vermeer. Manche Experten bezeichnen es als das teuerste Bild Österreichs. Über die Deutung herrscht unter Kunsthistorikern Uneinigkeit, meist wird die Darstellung aber als Sinnbild der Malerei oder der gesamten Kunst betrachtet. Abgebildet ist das lichterfüllte Atelier eines Malers, der mit dem Rücken zum Betrachter sitzt und ein Modell auf die Leinwand bannt.
Das Werk hat zahllose Interpretationen, Schriften, aber auch künstlerische Rezeption etwa durch Salvador Dali oder filmisch durch Maria Lassnig angeregt.
Graf Rudolf Czernin kaufte das Gemälde 1804 aus dem Nachlass Gottfried van Swietens und stellte es in seiner öffentlich zugänglichen Sammlung aus. In den 1920er-Jahren wurde das Bild vom Denkmalamt mit Ausfuhrverbot belegt, 1940 von Adolf Hitler erworben, 1945 an das KHM übergeben. Bis 1960 gab es mehrere abgewiesene Rückgabe-Ansuchen der Czernins. 2011 entschied die Kommission für Restitution gegen eine Rückgabe an die Erben.
Kommentare