Bestsellerautorin Vea Kaiser hielt "die Welt für gerechter, bevor ich Kinder bekommen habe"

Der Betrug ist männlich? Nicht in „Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“, dem neuen Buch von Vea Kaiser. Darin zweigt eine Hotelmitarbeiterin Millionen ab. Erzählt wird aber etwas ganz anderes. Im Interview erzählt Vea Kaiser - hier finden Sie ihre Kolumen in der KURIER freizeit - von niedrigeren Honoraren für Autorinnen, vom Schreiben im Keller und der Hoffnung, die ihr neue Leserinnen und Leser machen.
KURIER: Eigentlich, so denkt man sich am Ende von „Fabula Rasa“, sind Männer einfach zu emotional: Sie sind zu eitel, um das Grand Hotel rechtzeitig an die nächste Generation zu übergeben, zu Hallodri, um eine Beziehung zu führen. Die Frauen müssen das Leben viel nüchterner angehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Sie stellen damit dankenswerterweise Geschlechterklischees auf den Kopf, die es – so ist zu fürchten – immer noch gibt, oder?
Vea Kaiser: Also zunächst bedanke ich mich für diese kluge Lektüre! Der Roman ist als Ganzes ein großes Spiel mit Geschlechterklischees, schon allein aufgrund seiner Gattung: Schelminnenroman. Wir kennen unzählige Romane über Betrüger, Hochstapler, Gauner – aber Frauen kennt die Literatur tendenziell als die brave Angebetete oder die unschuldige holde Maid. Das wollte ich ändern. Es gibt ja nicht einmal eine weibliche Form des Wortes „Kavaliersdelikt“.

Als jemand, der im Wien der 1980er dabei war, denkt man sich zu Beginn: Ja, so war das (soweit man sich halt erinnert). Wie haben Sie denn dazu recherchiert – von den irgendwie traurigen Resten der New Wave über die besonderen Hürden, die ein Arbeiterinnenkind in der sogenannten besseren Gesellschaft erlebt (hat)?
Ich habe mir Menschen gesucht, die das, was mich interessiert hat, erlebt hatten oder darüber wussten. Ich habe Interviews mit Hoteldirektoren und Hausmeisterinnen, mit Buchhalterinnen und Menschen, die ihre Kindheit in Döblinger Gemeindebauten verlebten, geführt. Die größte Hilfe, um die Achtziger zu verstehen, war wahrscheinlich Ossi Schellmann, der frühere Besitzer und Gründer des U4: der hat mir Geschichten erzählt, die ich fast kaum glauben konnte. Und er war natürlich eine wunderbare Auskunftsperson, weil er als Geschäftsführer den Überblick behalten musste, während sich alle anderen in Rausch und Ekstase verloren haben. Wenn man so will, habe ich mich zuerst nach Art der Journalisten in den Stoff eingearbeitet, um dann als Romanerzählerin eine Geschichte daraus zu fingieren.
Die Geschichte von Angelika Moser beleuchtet eine Schieflage, die unverändert ist: Die Männer stehlen sich im entscheidenden Moment aus der Verantwortung – und die Hacke bleibt den Frauen. Ein bisschen denkt man sich: Ätsch, geschieht euch recht, dass die junge Frau diesen Schlendrian für ihr eigenes Fortkommen ausnützt. War das ein Gefühl, das Ihr Schreiben begleitet hat?
Tatsächlich hielt ich die Welt für gerechter, bevor ich Kinder bekommen habe. Damals dachte ich: Männer und Frauen sind doch heutzutage gleichgestellt. Aber spätestens seit ich Kinder habe, merke ich, dass dem nicht so ist: dass es am Ende des Tages fast immer die Frauen sind, die das Kartenhaus vor dem Einstürzen bewahren müssen. Dass Angelika Moser die Gefühle, Ängste und Geheimnisse der Männer rund um sich herum ausnutzt, war sehr befriedigend zu schreiben. Auch sie muss ein Kartenhaus zusammenhalten, aber dafür belohnt sie sich zumindest.
Das Buch
In ein Wien zwischen U4 und Opernball, zwischen Gemeindebau und Grand Hotel führt „Fabula Rasa“. Im Zentrum des neuen Romans von Autorin und freizeit-Kolumnistin Vea Kaiser steht Angelika Moser, die sich in einem Grand Hotel Millionen ertrickst. Das Buch steht bereits auf den Bestsellerlisten.
Zusatztermin bei Lesereise
Vea Kaiser ist mit dem Roman derzeit auf Lesetour. In Baden (Cinema Paradiso) wurde wegen des großen Interesses ein zweiter Termin eingeführt: Für den Zusatz-Slot am 11. 11. um 18 Uhr gibt es noch Tickets.
Zwischen den Kapiteln erhebt sich manchmal eine Autorinnenstimme, die – es gibt einen ähnlichen echten Fall - in der Justizanstalt recherchiert. Da liest man viel Persönliches und auch Einiges über das Leben als Autorin heraus. Wie weit ist da auch ein Art Protest von Vea Kaiser enthalten?
Diese Ungleichheit zwischen Männern und Frauen beschäftigte mich beim Schreiben immens. Während ich mich, um zu schreiben, um 21 Uhr aus dem warmen Kinderzimmer hinunter in den Keller schlich, reisten meine männlichen Kollegen auf die Seychellen, verschanzten sich in wunderschönen Aufenthaltsstipendien oder zogen sich auf Mutters Landgut zurück, um in Ruhe (d.h. ungestört von Frau und Kind) den neuen Roman zu schreiben. Mir war wichtig, zwischen den Kapiteln zu zeigen, wie sehr sich die Erzählerin (die natürlich ein Klon meiner Person ist) mit der Hauptfigur solidarisiert. Denn das ist ja das, was wirklich und auch sofort helfen würde: Wenn zumindest wir Frauen uns uneingeschränkt aufeinander verlassen könnten.
Erlebt man das im Literaturbetrieb auch so ähnlich wie Angelika Moser – den Männern fällt vieles zu, das man sich als Frau härter erarbeiten muss?
Früher musste ich oft mit Kollegen die Bühne teilen, die schlechter vorbereitet waren als ich, betrunken oder auch weniger Bücher verkauft hatten und trotzdem mehr Honorar bekamen. Das Hauptproblem ist aber vorrangig die Wahrnehmung.
Inwiefern?
Schreiben Männer gefühlsschwere Liebesromane, wird das von der Literaturkritik gern als „literarisches Meisterwerk“ tituliert. Schreiben Frauen gefühlsschwere Liebesromane, wird das oft als minderwertige „Frauenliteratur“ abgetan. Autoren dürfen alles, Autorinnen wird jede provokante Aussage übel genommen. Und ja, wir müssen mindestens drei Mal so viel leisten wie Männer, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Es gibt eine Anekdote, die erzähle ich dazu gern: Vor einigen Jahren las ich zum dritten Mal in einer sehr berühmten Buchhandlung. Die Buchhändlerin freute sich, mich wiederzusehen und gestand mir: „Bei ihrem ersten Buch dachte ich, na das ist ja sicher ein One-Hit-Wonder. Bei Ihrem zweiten Buch schien mir, Sie hätten ein zweites Mal so ein Glück gehabt. Bei Ihrem dritten hab ich verstanden: Sie können ja wirklich schreiben!“ Schreiben junge Männer ein gutes Buch, heißt es hingegen gleich: Der neue Thomas Mann.

Viel hätte nicht gefehlt, und Angelika Moser wäre durchgekommen. Darf man das Ende schade finden – es wird wieder nur eine Frau zur Verantwortung gezogen, die Männer bleiben mehr oder weniger unbehelligt?
Bleiben die Männer unbehelligt? Ich würde da widersprechen. Ich würde es eher so interpretieren: am Ende nur Verlierer, die gleichzeitig auch alle gewonnen haben: Die Einsicht, was wirklich wichtig ist. Und in wiefern Angelika Moser wirklich eine Verbrecherin ist: Das müssen die Leserinnen beurteilen.
Es begleitet Sie seit „Blasmusikpop“ das Diktum vom Popstar unter den heimischen LiteratInnen. Wie geht es Ihnen damit?
Haha, das ist so lustig, weil ich privat null Pop höre und mit dem Konzept „Popstar“ so wenig anfangen kann. Aber was Popstars wahrscheinlich charakterisiert, ist, dass das Publikum gern zu ihnen kommt und bei der momentanen „Fabula-Rasa“-Lesetour sind tatsächlich fast alle Veranstaltungen bis Jahresende ausverkauft, in Baden geben mein Pianist und ich am Dienstag sogar eine zweite Vorstellung aufgrund der großen Nachfrage. Und wenn das Popstar ist, dann muss ich sagen: Es ist großartig. Denn: zu merken, dass den Menschen das, was man macht, nahe geht oder Spaß macht, das ist das größte Privileg der Welt.
Dieser Status kann jedenfalls dazu verhelfen, Licht auf die Literatur zu werfen – die nämlich scheint in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten zu sein. Es heißt, dass immer weniger Menschen zum Vergnügen lesen, abseits der Hype-Bücher wird weniger berichtet.
Tatsächlich ist es schon traurig, dass über klassische Literatur weniger berichtet wird, dass der Raum dafür verschwindet, weil auch die klassischen Medien in der Krise stecken: wir sitzen sozusagen gemeinsam in einem Boot im Sturm. Was mich aber glücklich macht, ist, dass in Österreich im Gegensatz zu Deutschland kaum Buchhandlungen schließen. Leicht ist es nicht, aber sie halten sich sehr solide. Und daher mein Appell an alle, die Bücher lieben: Bitte bestellen Sie diese nicht bei amerikanischen Versandanbietern. Viele Buchhandlungen liefern versandkostenfrei, halten nebenbei Innenstädte lebendig, veranstalten Lesungen und empfehlen hochwertige Literatur.
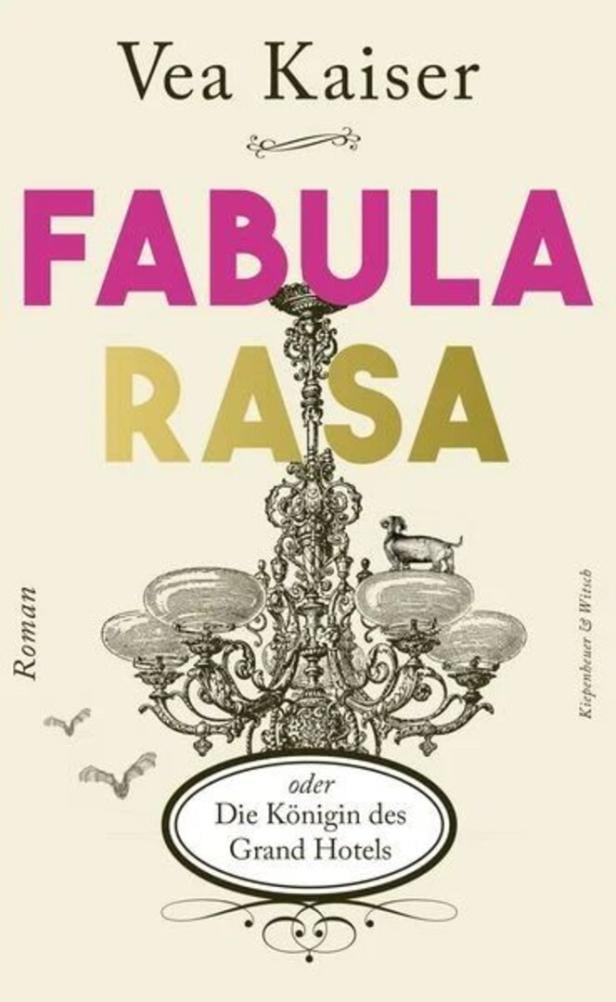
Hilft das?
Was mir Hoffnung macht, ist, dass junge Leute vermehrt das Lesen entdecken. Zurzeit gibt es einen regelrechten Booktok-Hype um gewisse Gattungen, aber ich seh das positiv. Was gelesen ist, würde ich nie bewerten. Denn Menschen, die lesen, finden irgendwann auch den Weg zu anderer Literatur, zu den Büchern, die die Essenz des Menschlichen einfangen. Es ist schon hart zurzeit, auch ich als Autorin muss viel mehr „mitarbeiten“, um dem Buch in die Welt zu helfen, aber ich bleibe guter Dinge: Solange gelesen wird, muss man sich um die Literatur keine Sorgen machen.
„Fabula Rasa“ wird als Comeback tituliert, obwohl Sie ja wahrlich nicht untätig waren. Sind die Zeitspannen, die Literatur eben manchmal braucht, in der heutigen, sich überpurzelnden Aufmerksamkeitsökonomie ein Problem?
Tatsächlich sind sechs Jahre eigentlich gar nicht so viel Zeit, um einen 570 Seiten Roman zu schreiben. Zwei meiner Lieblingsautorinnen, Donna Tartt und Jeffrey Eugenides, brauchen im Schnitt zehn Jahre für einen Roman. Und dass das Buch als „Comeback“ tituliert wird, das finde ich im Angesicht der Tatsache, dass ich seit dreizehn Jahren jeden Samstag eine Kolumne schreibe, fast putzig. Ich persönlich als Leserin finde ja, dass die Mehrheit der deutschsprachigen Autoren zu schnell schreibt.
Warum?
Mir ist es lieber, ein Autor, den ich mag, lässt sich ein paar Jahre Zeit und beschert uns dafür ein phänomenal gutes Werk, als er veröffentlicht regelmäßig halbgute Romane. Vor allem vor dem Hintergrund der sich überpurzelnden Aufmerksamkeitsökonomie! Menschen, die in dieser schnellebigen Zeit lesen, haben es verdient, das beste zu lesen, was eine Autorin zustande bringt: Und das bedeutet aber oft, nochmals und nochmals und nochmals zu überarbeiten. Es gibt ein schönes Sprichwort: Einer hat immer die Arbeit: entweder der Leser oder der Autor. Egal wie lange das dauert: ich finde, die Arbeit habe ich als Autorin zu leisten.
Kommentare