Karl-Markus Gauß filtert die "Nullerjahre"

Es sitzt der zeichnende Schriftsteller Paul Flora (1922–2009) im
Wiener Volkstheater in der Roten Bar und beobachtet ein schweigendes Ehepaar beim Essen.
Sie: vornehm und sehr alt.
Er: noch viel älter.
Beim abschließenden Kaffee sagt die Frau laut (weil vermutlich schwerhörig) zum Gatten:
"Es ist 13.50 Uhr, du benützt jede Gelegenheit, mich zu kritisieren, wenn die Leute dabei sind, bis zur Putzfrau. Überschreite dein Pouvoir nicht, bleibe, was du bist, klein und unwichtig, sonst hat mein Leben mit dir ein Ende."
Flora notiert es.
Er war auch einer, der das Wesentliche im Leben erkannte. Die Mitschrift schenkte er Karl-Markus Gauß, und nun steht sie in "Ruhm am Nachmittag" .
Vielleicht sind die 280 Seiten ein Tagebuch – so in der Art von Sándor Márai, der jenes festhielt, was sich in seinem Innersten niederschlug. Was im Ich übrig bleibt. Wahrscheinlich ist "Ruhm am Nachmittag" ein Jahresbuch, nämlich von 2009, dem letzten der " Nullerjahre".
Ein Journal, wie die Franzosen sagen. (Es ist sein viertes.) Aber ganz sicher ist es völlig egal, wie man dieses Buch nennt. Hauptsache, man hat viel davon.
Der Unterschied
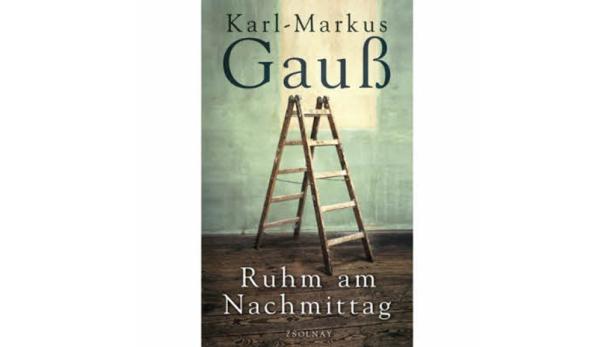
Der 57-jährige Salzburger Autor, Publizist, Essayist hat schon im vorangegangenen "Zu früh, zu spät" ausgedrückt, was er sein will: Hinschauer, kein Zuschauer!
Zuschauer haben sehr gelacht, als Thomas Bernhard im 2009 posthum erschienenen "Meine Preise" erzählte: Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg schlief während der Verleihung des Grillparzer-Preises ein.
Hinschauer aber haben Firnberg ihren Schlaf gegönnt.
Hinschauer haben nicht vergessen: Sie hatte an Österreichs Universitäten die Demokratie eingeführt. Sie hatte den freien Zugang durchgesetzt. Sie hatte den Professoren ihre Selbstherrlichkeit genommen. Ein harter Kampf. Die alte Firnberg hatte ein Recht, müde zu sein.
Soweit zum Unterschied.
Er macht Karl-Markus Gauß aus.
Freilich zieht sich durch die Aufzeichnungen der Jammer, dass so viele hohle Nüsse an den Machtpositionen sitzen. Aber es ist breit gestreut, was durch Gauß’ Filter auf uns zukommt.
Gedanken zur TV-Sendung "Die Küchenschlacht" ebenso wie übers öffentliche Sterben; und der Aufruf, den vergessenen Wiener Schriftsteller Richard Bermann zu lesen; und Rumänien, Pakistan, Albanien; und Erinnerungen an zwei verfeindete Wohnungsnachbarn in Salzburg.
Den Stil wechselt er, er fabriziert sogar kurze Krimis – aber nur aus Ärger, weil heutzutage jeder glaubt, Krimiautor sein zu müssen. Bei Gauß klingt das so: "Winter war weder groß noch schlank. Aber auch wenn man ihn als mittelgroß oder vollschlank bezeichnet hätte, würde man ihn nicht korrekt beschrieben haben."
Und fragt ihn jemand, wie sie denn so waren, die "Nullerjahre", so antwortet er: Da war nicht nur Terror und Krieg und das Spiel der Börsianer ... "nein, das waren auch zehn Jahre unseres Lebens, wir werden sie kein zweites Mal haben."
Auf "Ruhm am Nachmittag" passt ein Spruch, der auf Facebook die Runde macht, besonders gut:
Lesen gefährdet die Dummheit.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: ***** von *****
Tom McCarthy - "K"
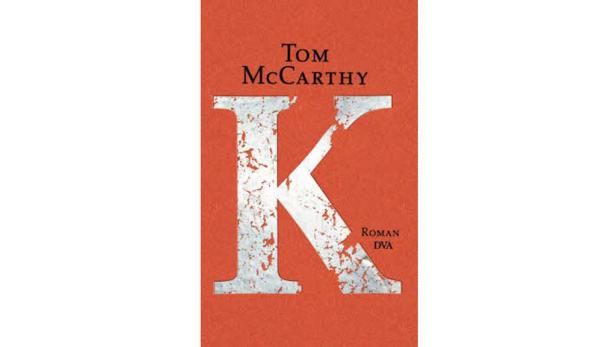
Es ist nicht so, dass das Buch nichts hätte.
Die Stelle etwa, an welcher der Held des Romans eine Séance stört, weil er eine mit mehr Volt betriebene Fernsteuerung als die des Geisterbeschwörers einsetzt. Sehr zur Verwunderung des Betrügers, weil das "Tischchen" nie auf den Buchstaben rückt, auf den er es rücken will.
Oder, dass man erfährt: Es gab bereits um 1900 Audioguides für Museen. Sogenannte "Sub-Berliner": ein Grammofon samt Kopfhörern; der Erklärtext kam von einer Schellackplatte.
Ansonsten gibt es einiges, was Tom McCarthys "K" nicht hat. Ein Glossar fehlt.
"K" ist das dritte Buch des Londoner Autors. Und es ist seltsam. Vordergründig ein Bildungsroman, verfasst in nachgeahmt viktorianischem Schreibstil, den die gute, alte Virginia Woolf als antiquiert gebeutelt hätte, erzählt McCarthy alles und nichts.
Licht der Welt oder wie es Fans und Verlag des gefeierten Popliteraten formulieren: Er erzählt "über die Ära, in der die Technologie das Licht der Welt erblickt".
Es geht um die Entwicklung der modernen Kommunikation. Der Buchstabe K – im Englischen heißt das Buch "C" – ist ergo Konzept. Dem alles unterworfen wird. Das geht so weit, dass aus dem britischen Protagonisten Serge Carrefax auf Deutsch ein K arrefax wird.
Dessen Vater, die Handlung zieht sich von 1898 bis 1922, arbeitet (erfolglos) an der drahtlosen Übertragung bewegter Bilder. Er will ein "Sofort- K inemaskop" schaffen. Serges Schwester, ebenfalls Naturwissenschaftsnärrin, begeht nach einem fehlgeschlagenen Feldversuch Selbstmord. Das führt bei Serge zu chronischer Verstopfung, die er im tschechischen K urbad K loděbrady zu heilen versucht.
Danach erlebt er als Funker die Schrecken des Ersten Welt k riegs, wird im Swinging London K okainsüchtig. Und später als Geheimdienstler in Ägypten in einer Pharaonen- K rypta beim Austausch von K örperflüssigkeiten (=Sex) von einem K äfer gebissen. Er stirbt.
Das hat man bei Roth, Mann, Remarque, Faulkner, selbst bei Agatha Christie, schon besser gelesen. McCarthys Serge ist kein mit Liebe modellierter Charakter, er ist ein Sprachrohr für überkandidelte Wortspenden und Technik-Hirnwichserei.
Marconi und Pohl Zur Handhabung von Zweiterer werden einem Namen wie Marconi (italienischer Pionier der Telegrafie und 1909 Physiknobelpreisträger) oder "von Pohl" aufs Auge gedrückt. Mit diesem ist Vater Karrefax nämlich in Briefkontakt. Ob es Maximilian, der deutsche Fliegergeneral, Hugo, der Admiral, oder sonst ein Pohl ist – keine Ahnung. Wo ist das Glossar?
McCarthy reißt unzählige Themen an und führt keines zu Ende. Das Meiste bleibt Schablone. Löchrig. Und das ist K äse.
Michaela Mottinger
KURIER-Wertung: *** von *****
Friederike Mayröcker - "ich sitze nur GRAUSAM da"
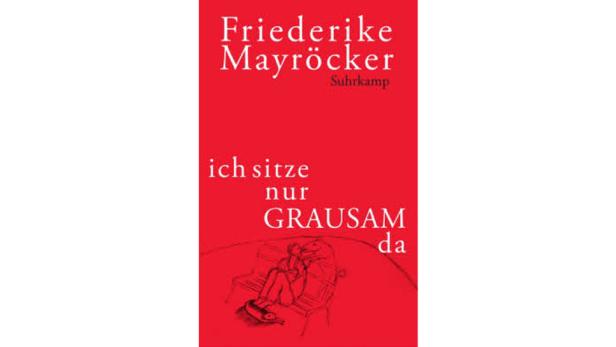
Sie schreibt oft im Bett, das ist bekannt. Neu ist, Friederike Mayröcker schreibt mitunter so lange Zeilen, dass das Blatt Papier aufhört. Dann stehen schwarze Filzstiftbuchstaben auf dem Bettzeug.
Was könnte aus "ich sitze nur GRAUSAM da" , einem Prosaband (wobei der Unterschied zu ihrer Lyrik nicht groß auffällt), irrtümlich auf dem Bettzeug verewigt sein?
"Hortensie" kommt oft vor, denn es ist Sommer im Buch, es ist das Blühendste ihrer Bücher; "Glyzinie" und "Olivenbaum" und vor allem "Ely" – damit ist ihr Lebensmensch Ernst Jandl (1925–2000) gemeint.
Ihm sagt die 87-jährige Wienerin noch heute, dass ihre Seele " 1 kl. Taschenlampe" ist, mit der sie unbekannte Winkel der Welt (=der Sprache) ausleuchtet.
Das muss sie depressiv machen und glücklich zugleich, und mag auch das Hirn beim Lesen "Was ist los?" fragen – die Seele versteht’s, denn Friederike Mayröcker schreibt nicht nur mit der Seele, sondern auch für sie.
Egal, ob sie nun einen Wadenkrampf erwähnt, verstreute Zuckerstücke vom Boden aufhebt oder sich an Olivenbäume in der Toskana erinnert.
Und es stimmt ja nicht, sie sitzt nicht bloß "grausam" zwischen Papiertürmen in Wien-Margareten.
Die Dichterin ist in diesem Buch sogar ausgesprochen viel unterwegs, im Votivpark, beim Belvedere, schnabulierend im Restaurant " ON" – und im Geiste reist sie zurück zum Seidelbast von Camaiore, zum Schwan auf der geliebten Traun ... wo sie die Hände faltet und sich ins Geäst hockt.
Immer mit dem erklärten Ziel, die Sprache der Kirschblütenzweige zu lernen, so zart und zerbrechlich. Kann sein, dass noch ein, zwei Staubblätter fehlen. Aber bestimmt nicht mehr.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: ***** von *****
Kommentare