Julian Barnes: "Unbefugtes Betreten"

Da saß ein Mann gemütlich auf einem öffentlichen Klo und bemerkte, dass unten an der Seitenwand etwas schräg hingeschrieben war. Also bückte er sich und las, was dort stand: "Jetzt scheißen Sie in einem 45-Grad-Winkel." Diese Sitzung wird von
Julian Barnes erzählt (zwischendurch), Booker-Prize 2011,
Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2004 usw. 66 ist er heuer geworden. In "Unbefugtes Betreten" kommen auch Orangenmarmelade, Spermaverkostung und Ekelzwerge vor; und es könnte der Eindruck entstehen: Julian Barnes habe sich etwas Unbeschwertes gegönnt. Nach dem Tod seiner Frau Pat schrieb er "Nichts, was man fürchten müsste" (2008): Mit diesem Essay versuchte Barnes, seine Angst vor dem Tod zu vertreiben. Dann folgte 2011 "Vom Ende der Geschichte", sein bisher bestes, unangenehmstes Buch: Was der Mensch mit Lügen aus sich macht ...
Es wäre kein Wunder gewesen, hätte er sich jetzt in seinem Humor ausgeruht. Hat er nicht. In den 14 neuen Erzählungen setzt er uns mit der Liebe zu (ohne dass dieses Wort oft verwendet wird). Mit der Liebe – und fast immer mit dem Verlust des Partners.
Geruch
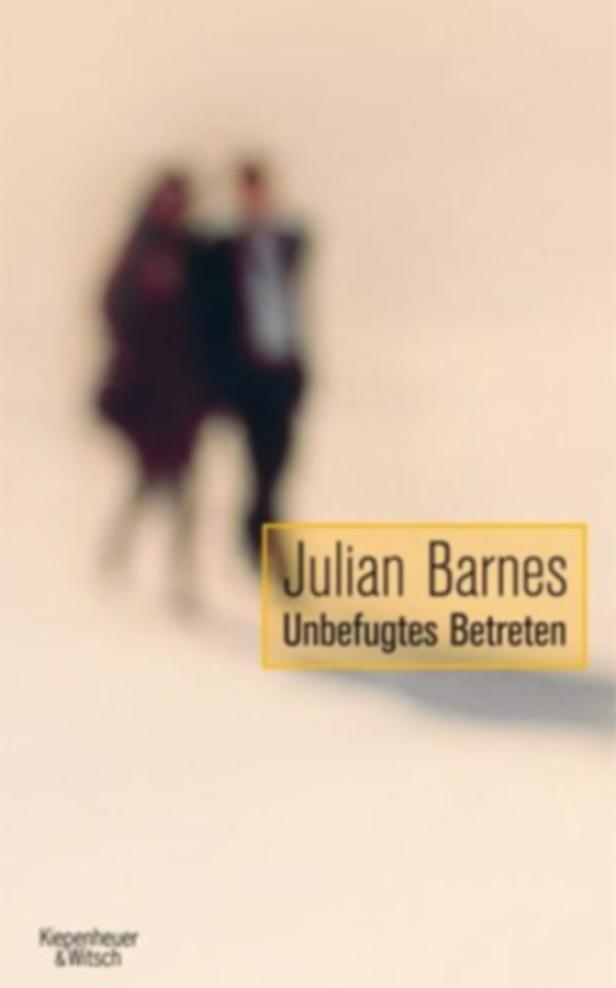
Das kann ins Historische gehen wie bei Garibaldi und der an seiner Seite kämpfenden Anita. Oder wie beim Wiener "Wunderarzt" Franz Anton Mesmer und der blinden Pianistin Maria Theresia Paradis – von Alissa Walser in "Am Anfang war die Nacht Musik" ausführlicher und intensiver dargestellt. Aber meistens stehen "wir" im Zentrum. Ein Mann, der seine Frau nicht mehr riechen kann, er hat den Geruchssinn verloren. Eine Frau, die fliehen muss, weil der Freund ihr kein Geheimnis lässt. Und selbst wenn zwei Ehepaare in vier der Geschichten miteinander essen, trinken, lustig sind, steuert alles auf den einen Punkt zu. "Was ich eigentlich sagen wollte: Wir sprechen nie über die Liebe."
"..."
"..."
"..."
"Genau das meine ich." Und dann drückt sich diese Abendgesellschaft, in dem über Sex geplaudert wird.
Julian Barnes’ Dialoge sind es, von denen man nie genug bekommt. Sie machen alles leicht, selbst das Schrecklichste: Calum sucht nach dem Tod seiner Frau die Erinnerung, er fährt auf eine Insel, wo er mit ihr glücklich war. Es hilft nichts – "Er hatte geglaubt, er könne sich das Vergangene wieder zu eigen machen und dann langsam Abschied nehmen. Er hatte gedacht, Kummer ließe sich lindern ... Aber er konnte nicht über den Kummer gebieten. Der Kummer gebot über ihn." (Peter Pisa)
KURIER-Wertung ***** von *****
Chad Harbach: "Die Kunst des Feldspiels"
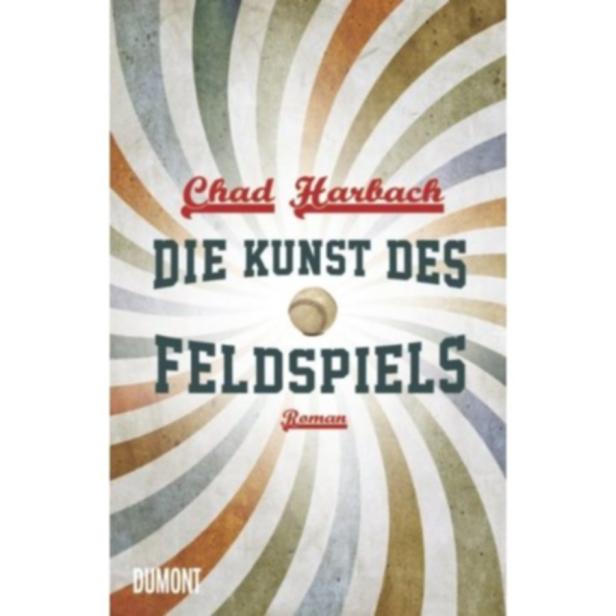
Die schlechte Nachricht für Baseball-Ignoranten: Im Romandebüt "Die Kunst des Feldspiels" geht’s um Baseball. Die gute: Auch einer der Protagonisten interessiert sich nicht sehr für Baseball. Obwohl er Baseball spielt – und mit seinem Desinteresse sogar zum Liebling des Coachs avanciert, der ihn liebt wie "ein Priester, der sein einziges ungläubiges Gemeindemitglied zu würdigen weiß". Der ungläubige Owen Dunne mag Literatur, Mode und junge Männer. Am Ballspiel interessiert ihn nur: "Man steht so viel herum. Das und die Taschen in der Spielerkleidung."
Das Buch schlug Wellen. Endlich, atmeten US-Kritiker auf, sei der große amerikanische Roman unserer Zeit da: Die Gegenwart, erzählt durch die Baseball-Metaphorik. Dabei könnte man böse sein: Er klingt wie aus einem Schreibseminar. Harbach hat sich das Lob hart erarbeitet. Er studierte in Harvard und werkte als PR-Mann, um seine hohen Schulden (wegen der Uni-Gebühren) abzuzahlen. Zehn Jahre saß er am Buch. Dabei musste die Coming-of-Age-Geschichte (von Johann Christoph Maas Stephan Kleiner übersetzt) ein Erfolg werden: Beeinflusst von Melville, Faulkner, beobachtet Harbach mit der Genauigkeit Jonathan Franzens – und schlägt John Irvings erzählerische Volten: Schon der Plot rund um den kleinwüchsigen Henry Skrimshander, der sein Schicksal und das seines Zimmerkollegen Owen mit einem fehlgeleiteten Baseball drastisch verändert, liest sich wie die Reverenz an "Owen Meany". Verweise auf Dichterkollegen kann, muss man aber nicht erkennen, um diesen Roman zu lieben; trotz des Literatur-Strebertums. (Barbara Mader)
KURIER-Wertung: ***** von *****
Juli Zeh – "Nullzeit"
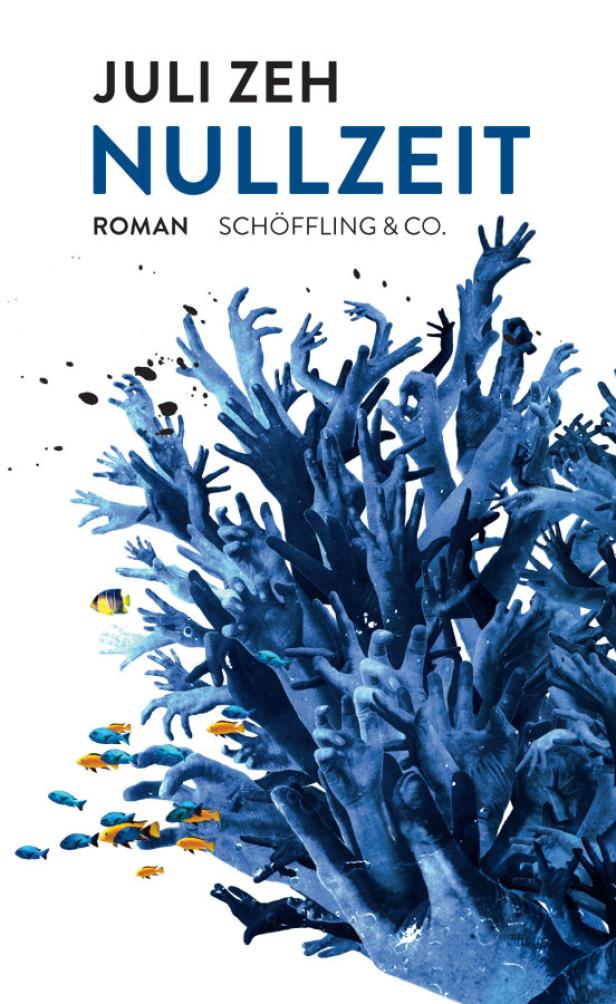
Es wird zwar mehrmals erklärt, was Taucher mit " Nullzeit" meinen. Aber egal, ob man es versteht: Sven ist ohnehin meist tiefer als 50 m im Wasser, und da hat man keine Nullzeit, da muss man Stopps einlegen, Dekompressionsstopps, um gesund "oben" anzukommen. Sven wird lange warten müssen, um nach Juli Zehs Psychothriller wieder halbwegs Boden unter den Füßen zu bekommen. Er war aus Deutschland geflüchtet, um sich "rauszuhalten". Solche Typen mag die 1974 in Bonn geborene Autorin ganz und gar nicht. Juli Zeh kämpft, streitet, mischt sich im positiven Sinn ein, in die Politik z. B.
Ihr Sven aber tauchte ab, er hielt die Besserwisser nicht aus, das ständige Urteilen-Müssen. Auf Lanzarote hat er seit vielen Jahren eine Tauchschule und Ruhe. Seine hübsche, treue, genügsame Freundin kümmert sich um die Unterbringung und Verpflegung der Urlauber. Und dann kommt ein Paar, das zeigt: Man kann nicht entkommen, man ist nicht einmal bei den Fischen sicher. Angenehm verwirrend wird, was folgt. Unangenehm berührend. Man vergisst, wie konstruiert, überkonstruiert "Nullzeit" ist.
Die fremde Frau ist Schauspielerin, sie würde gern im Film über Lotte und Hans Hass die Lotte spielen. Deshalb will sie tauchen lernen. (Wir wissen, die Rolle hat Yvonne Catterfeld bekommen). Der Mann ist Schriftsteller, auch nicht sehr erfolgreich. Sie führen offensichtlich eine Sadomaso-Beziehung. Sven wird hineingezogen. Aus seiner Erzählung geht hervor, dass er seine Tauchschülerin abweist. Aus ihrem Tagebuch geht hervor, dass er zudringlich ist. Man neigt dazu, Sven zu glauben. Warum aber wenden sich die Inselbewohner schimpfend von ihm ab?
Man kommt beim Lesen ins Schwitzen. Vor allem unter Wasser hat der Roman Szenen, bei denen einem kurz die Luft wegbleibt. (Peter Pisa)
KURIER-Wertung: **** von *****
Kommentare