Eine französische Brücke als Hauptfigur

Der Held ist sechsspurig. Er besteht aus 60 Millionen Tonnen Beton, 80.000 Tonnen Stahl, 129.000 km Kabel – und er menschelt trotzdem (ein bisschen).
Zumindest im französischen Original wird extra darauf hingewiesen, dass dieser Wahnsinn auf die Welt gekommen ist wie du und ich. Da heißt der Titel, übersetzt: "Die Geburt einer Brücke".
Der Suhrkamp Verlag begnügte sich mit "Die Brücke von Coca", weil die zwar der Motor des Buchs ist – aber es sind schon die vielen Geschichten "richtiger" Menschen aus aller Welt, Arbeitslose und Abenteurer, die bauen und lieben und hassen und abstürzen.
Maurer, Kranführer, Pizzabäcker, Huren, Zahnärzte, Asphaltbauer, Saboteure, Kabelmonteure, Schweißer aus China, Tunesien, Finnland ... sie geben dem Roman seine Kraft.
Die Brücke trommelt den Rhythmus.
Die Arbeiter müssen dazu tanzen.
Knapp ein Dutzend lernen wir genauer kennen, auch deren Vorgeschichte – aber immer nur kurz. Selbst die Sexszene zwischen dem Boss und der Lenkerin einer Planierraupe kommt mit drei schönen Takten aus.
Sie, dreifache Mutter, zieht den Pulli aus: "Ich warne dich, das ist alles, was ich anzubieten habe."
Er, ein beschädigter Steve-McQueen-Typ: "Das ist schon sehr viel."
Sie: "Das meine ich auch."
Wichtiger ist, was sich direkt auf der Baustelle abspielt. Wichtiger ist, was diese kleine globalisierte Welt in den Köpfen bewirkt.
Infektion
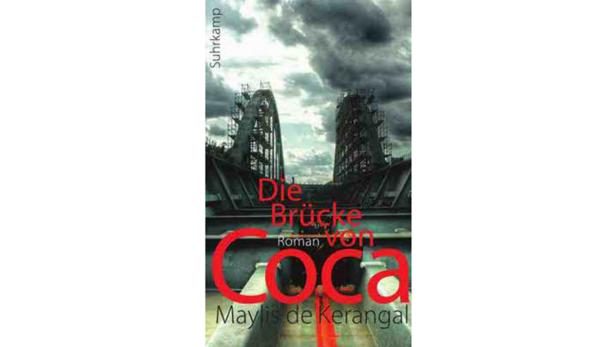
Coca ist eine Fiktion der französischen Schriftstellerin Maylis de Kerangal. Kann sein, dass diese Stadt (dieses Nest) in Südkalifornien liegt, in Mexiko oder Panama: Es ist völlig egal. Coca ist da und dort und vor allem in den Gehirnen.
Der neue Bürgermeister, korrupt und mit Haarimplantat, hatte sich auf einer Reise in Dubai infizieren lassen. Seither ist er süchtig nach modernem, soll heißen: gigantischem Zeug.
Der historische Stadtkern ist ihm Ärgernis.
Die Brücke mit den zwei 230 m hohen Türmen und den dicken Seilen aus jeweils 27.572 Stahldrähten – die soll Coca aus der Isolation führen, in die Zukunft, Richtung Meer. Der Wald muss weg, die Indianer müssen weg. Alles bloß Fliegenschiss im Vergleich ...
Die 43-jährige Maylis de Kerangal wertet nicht. Sie ist an keiner Stelle parteiisch.
Ihre Aufgabe war, "Die Brücke von Coca" nah am Sachbuch zu bauen, technisch genau, ohne dass der Beton die Augen verpickt.
Im Gegenteil: Groß werden sie. Das funktioniert ganz automatisch. Dann kann man besser sehen, was aus uns geworden ist – unter einem Himmel, der auch schon wie lackiert aussieht.
KURIER-Wertung: **** von *****
Chandrahas Choudhury – "Der kleine König von Bombay"
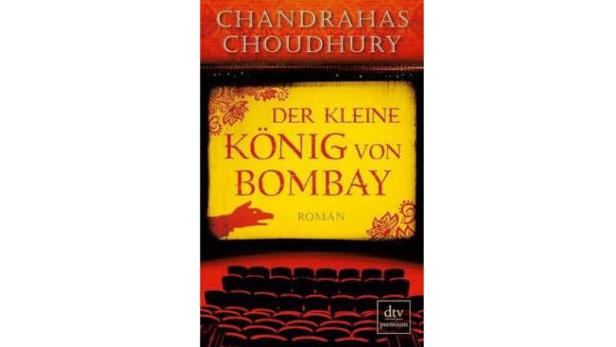
Hat schon gewonnen. Ein Buch, das in einem altmodischen Kino spielt, noch dazu in Mumbai ... und ein Filmvorführer Mitte 20, der klein ist, sehr, sehr klein, wird unser Freund: Da kann wirklich nicht viel schief gehen.
Da geht nichts schief, weil der indische Autor in seinem Romandebüt viel spürt und diese warmen Bilder gefühlvoll weitergeben kann.
Der zwergenhafte Arzee ist ein starker Typ, der im Kino seinen Platz gefunden hat. Sein Vorführraum liegt erhöht, er kann also zumindest hier auf die Welt hinunter schauen. Und im Finstern träumen: Von der feschen Friseurin etwa, die nicht so oberflächlich ist wie die anderen – aber leider von ihrem Vater, der gegen die Beziehung ist, "weggeschafft" wurde.
Erwartungsgemäß soll das legendäre, mottenzerfressene Kino, das zu wenig Geld abwirft, zugesperrt werden. Es heißt "Noor" – Licht. Es bringt Licht, Illusionen, Hoffnungen, es holt die Menschen aus der Verzweiflung und muss deshalb bleiben.
"Der kleine König von Bombay" wird dafür sorgen. Er wächst über sich hinaus. Als Leser freut man sich über gutes Futter für die Seele.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: **** von *****
Ana Tajder – "Titoland"
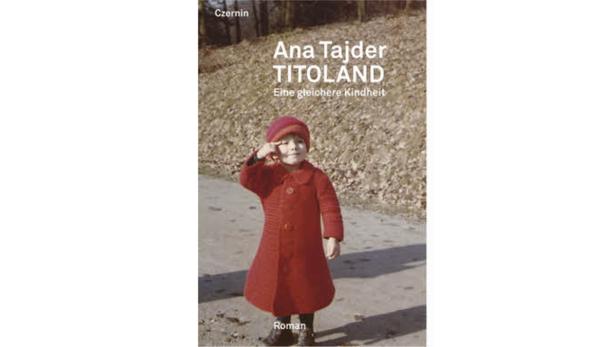
Bei Tito waren alle gleich, manche jedoch gleicher. So ähnlich steht es schon bei George Orwell, wo alle Tiere gleich, manche jedoch gleicher sind.
"Titoland" von Ana Tajder erzählt vom Aufwachsen im Jugoslawien der 70er-Jahre. Tito sorgte für alle, aber er glaubte nicht, dass seine Söhne ein besonderes Leben verdienten. Einer von ihnen lebte in der Nachbarschaft der Autorin. Nach Titos Tod kümmerte er sich um die Pudel, die Tito gehört hatten. War er nun gleich oder gleicher? Tajder erzählt viel Interessantes über Tito.
Sie liefert allerdings auch Informationen, deren Wert sich nicht erschließt: Etwa, dass in ihrer Schultasche Hefte und bunte Stifte waren. Die Nachricht, dass auch in Jugoslawien junge Mädchen " Dirty Dancing" schauten, liegt in puncto Informationswert dazwischen. Bemerkenswert: Kurz nach " Dirty Dancing" wendet sich die frühreife Protagonistin – mit 15 – der Lektüre von Marcel Proust zu. Später (!) Hesse.
Ana Tajder, 1974 in Zagreb geboren, lebt in Wien. Laut Verlag arbeitete sie u. a. im Marketing. Ihr erster Roman "Von der Barbie zum Vibrator" erhielt großes Medienecho.
Barbara Mader
KURIER-Wertung: **** von *****
Kommentare