Ein Filmkünstler mitten im Kommerz

Eigentlich war geplant, dass er seine Filme in den Ozean vieler Filme wirft, dass sie dort untergehen, verschwinden.
„Und irgendwann, in Jahrhunderten, sieht sie dann vielleicht wieder einer, irgendwo bei einem Felsen im Meer glitzern.“
Nun, das ist schneller geschehen.
Aber Dominik Graf, so viel steht fest, ist ein eindrucksvoll bescheidener Mann. Die Ehrungen häufen sich gerade für ihn. Aber der Anfang war hart, sehr hart. Am Anfang dachte Dominik Graf, der Beruf des Filmregisseurs sei doch nichts für ihn. Da hatte der Münchner gerade die Filmakademie absolviert und eine Handvoll von Filmen gemacht, mit denen er „ganz und gar nicht zufrieden war.“
Bis er zum Polizeifilm fand.
„Den konnte ich“.
Zehn Grimme-Preise später (Er ist Rekordhalter); nach dem virtuosen Kinohit „Die Katze“ (1988, mit Götz George und Gudrun Landgrebe); nachdem er mit legendären Tatort-Folgen oder Serien wie „Im Angesicht des Verbrechens“ (2010) Fernsehgeschichte geschrieben hat, ehrt ihn nun auch die Kinowelt.
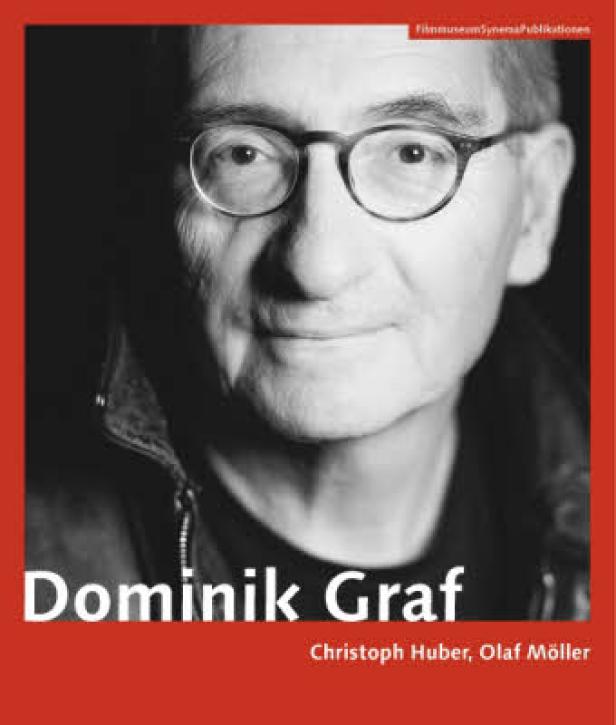
Wie Graf diese Anerkennung als einer der „wichtigsten Regisseure der deutschen Nachkriegszeit“ sieht?
„Ich bin verwirrt“, sagt der 60-Jährige und dass er das so ganz und gar nicht so geplant hätte. „Ich finde, ein Regisseur sollte hinter dem Film und den Schauspielern verschwinden. Als namenloser Handwerker arbeitet es sich doch am unbelastetsten.“
„Es gibt eine Fama um Hitchcock. Man hat gesagt: In dem Moment, wo er wusste, dass er berühmt war, hat er keine guten Filme mehr gemacht, seine Originalität verloren“.
Pause. „Im Moment ist also die Gefahr groß ...“, grinst Graf.
Wir sitzen im Café Tirolerhof, Graf hat den ganzen Tag Studenten der Theaterwissenschaft unterrichtet, zwei Präsentationen im Filmmuseum stehen noch am Plan.
„Freizeit?“, sagt er, „Was meinen Sie damit?“ Er selbst arbeitet im Moment an einem neuen Kinofilm, dem ersten seit „Der Felsen“ (2006). Wieder ein historischer Stoff: um Friedrich Schiller und zwei Frauen. Auch davon erzählt Graf gerne: von Dreiecksgeschichten (wie das Buch so klug herausarbeitet) und starken Frauen. Frauen, die schon mal ihre Polizeikollegen anspringen und mit ihnen raufen. „Ich mag es eben lebendig“, sagt er, „Ich habe vielleicht ein anderes Bild von Frauen als politisch korrekt üblich. Aber ich mag nicht davon absehen, dass Frauen für uns Männer auch etwas Verführerisches sind“.
Vor allem spielen die Frauen bei ihm gut, besser als überall sonst im TV.
Was ist denn da sein Geheimnis?
„Als ich in den 70er-Jahren anfing, war das Schauspiel meist noch sehr theatralisch. Da habe ich immer nur gesagt: ‚Weniger, mach’ weniger.‘ Im Grunde mache ich heute auch nicht mehr“. So einfach kann klingen, was äußerst komplex aussieht.
Wie es denn überhaupt sei, all den alten Werken wiederzubegegnen?
„Ich schau mir die Filme nicht an. In der Öffentlichkeit vor anderen Leuten kann ich das gar nicht. Ich erinnere mich soundso an jedes Detail. Ich werde so tief beeindruckt von den Menschen, mit denen ich arbeite. Das geht ganz tief. Und ist auch der Grund, warum ich das alles überhaupt mache.“
Kommentare