David Vann: Eiskalt gefangen in der Ehe

Irene war zehn, als ihr Vater die Familie verließ; als sie von der Schule kam und die Tür des Holzhauses öffnete; als sie sah, wie ihre Mutter an den Dachsparren hing.
"Entschuldigung", sagte Irene und ging auf die Veranda zurück ... Jetzt ist sie 55. "Das hast du gesagt?", fragt ihre Tochter. "Du hast gesagt, Entschuldigung?" "Ja." "Oh, Mom."
"Die Unermesslichkeit" ist ein tragisches Buch. Es gibt keinen Trost. Das Schlimmste wird garantiert passieren. Wie schon in "Im Schatten des Vaters" (2011) deprimiert der Amerikaner
David Vann und bereichert dadurch hoffentlich. In der Verwandtschaft des 45-Jährigen haben sich fünf Menschen umgebracht.
Der Satz, den Irene spricht und auf den es ankommt, lautet: „Man kann sich zwar aussuchen, mit wem man lebt, aber nicht, was aus ihm wird.“ Sie hatte sich vor 30 Jahren Gary ausgesucht. Damals studierte er Skandinavistik. Dann brach er ab. "Entführte" seine Frau an die Küste Alaskas. Fing dort alles an. Brachte nichts zusammen. Ist auch für sich selbst eine Enttäuschung. Irene war Lehrerin.
Was jetzt? Längst gingen Tochter und Sohn eigene Wege. Irene, als Klügere, hätte Gary verlassen müssen. Aber sie wartet gern ab, bis er versagt, und dann kann sie ihn bestrafen, demütigen.
... und jetzt hat Gary wieder so einen Plan, mit dem er die Ehe retten will. Das sagt er aber nur so. In Wirklichkeit will er sich seinen wilden Traum erfüllen. Auf einer winzigen Insel, Caribou Island, hat er Land gekauft, und dort baut er eine einfache Hütte. 20 Quadratmeter. Ideal für zwei, die nichts mehr aneinander suchen und finden.
Klo? Unnötig. Heizung? Nicht daran gedacht (aha, in Alaska) ... Ein Fenster könnte nicht schaden!
Zu traurig für Slapstick
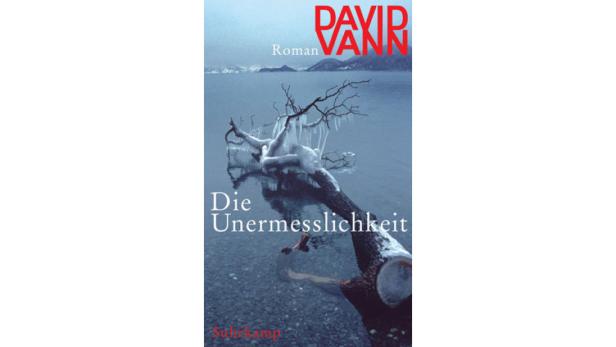
Es wäre Slapstick: Bei strömendem Regen bildet sich Gary ein, Baumstämme vom Festland auf die Insel schaffen zu müssen. Er zieht sie aufs Boot.
Irene will nicht, aber hilft (denn sie freut sich schon auf die spätere Bestrafung ihres "Alten").
Dann ist das Holz an Bord. Das Boot liegt voll beladen am Strand und lässt sich nicht ins Wasser schieben. Viel zu schwer.
Es wäre Slapstick, doch kommt man nicht auf die Idee zu schmunzeln. Es ist nur traurig. Man friert. Dafür sorgt auch die kalte Sprache .
Würde David Vann wenigstens der nächsten Generation eine Chance geben! Tut er nicht. Der nie. Die Tochter der beiden, Rhoda, hat einen Freund, der ist Zahnarzt und hält sich mit Hanteln fit – für andere Frauen. Er denkt sich: Wenn ich schon so nett bin und Rhoda heirate, no, dann möchte ich wenigstens nebenbei was Ordentliches haben.
Wir entkommen uns nicht. Danke für die Schreckensbotschaft.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: ***** von *****
Téa Obreht: "Die Tigerfrau"

"Die vierzig Tage der Seele beginnen am Morgen nach dem Tod." In der ersten Nacht liegt die Seele des Verstorbenen noch auf dem verschwitzen Kissen und beobachtet die Lebenden beim Händefalten, dann wird die Seele umtriebig. Sie öffnet Schranktüren, lärmt, macht sich bemerkbar. Das gehört zum Leben dazu.
Die Selbstverständlichkeit, mit der Téa Obreht in "Die
Tigerfrau" über Aberglauben schreibt, fasziniert. Doch die wandernde Seele ist mehr als Aberglaube. Sie ist der Eingang zu Großvaters Geschichten von der Tigerfrau und dem Mann, der nicht sterben kann: Sie werden das Verständnis für die Welt erschließen.
Natalia ist Ärztin, irgendwo in Südosteuropa. Mit ihrer Freundin ist sie unterwegs, um Waisenkinder mit Impfstoff zu versorgen. Dort erfährt sie vom Tod des Großvaters. Auf dem Weg ins Spital erinnert sich die junge Frau an ihre Kindheit mit dem Großvater. Diesem Unbeugsamen, der sich der Zwangsschließung seiner Ordination widersetzte und seine Patienten von nun an daheim besuchte.
Eine Erzählung über das Erzählen.
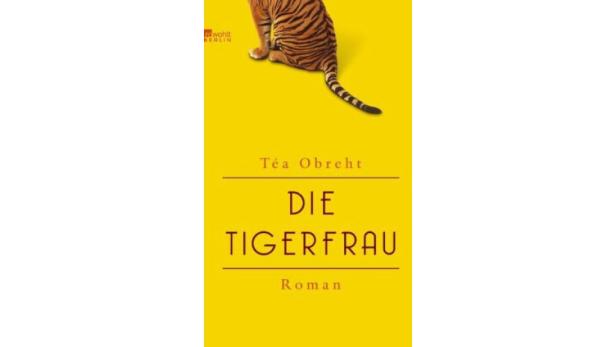
Ein ungewöhnlicher Mann. Aufrecht, stets in langer Hose und langärmeligem Hemd, schritt er mit seiner Enkelin an der Hand wöchentlich zum Zoo. Als der Tiger einmal dem Wärter den Arm beinahe abbiss, sagte der Großvater zum ihm: "Sie sind aber auch ein Idiot."
Wo sich das alles abspielt, erfahren wir nicht. Ortsangaben spielen keine Rolle; das Dorf Galina, in dem der Großvater geboren wurde, "erscheint auf keiner Karte". Realistisches Erzählen kümmert Obreht wenig: auch Zeit ist relativ, die Erzählung springt mühelos zwischen Dreißigerjahren und Gegenwart hin und her. Leichtfüßig erzählt die Autorin Fantastisches: Vom Mann, der nicht sterben kann und dies anhand einer Kaffeetasse ohne Sud beweist.
Obreht stammt aus Belgrad und kam, nachdem sie 1992 mit ihrer Mutter und ihren Großeltern die Stadt auf der Flucht vor dem
Krieg verlassen hatte, nach Stationen in Zypern und Kairo erst als Zwölfjährige nach
Amerika. Nach mehreren Erzählungen ist "Die Tigerfrau" der erste Roman der 25-Jährigen.
"Die Tigerfrau" ist eine Erzählung über das Erzählen: Über die Kraft und den Trost, die darin liegen. Und es ist tatsächlich tröstlich, dass hin und wieder jemand wie Téa Obreht auftaucht: Jemand, der solche fantastischen Geschichten weiß. So einfach kann es sein.
Barbara Mader
KURIER-Wertung: ***** von *****
Maria Sonia Christoff: "Unbehaust"
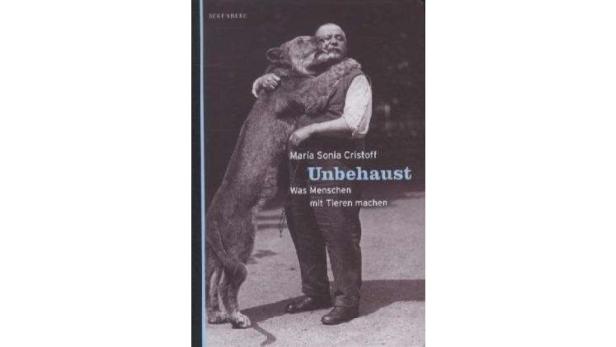
Maria Sonia Christoff – Jede Nacht um drei Uhr Sex, das ist zu viel –, wenn man nur die Geräusche aus einer Nebenwohnung hört und deshalb nicht schlafen kann. Ein Schalltechniker ist keine Hilfe, und deshalb zieht sich die argentinische Autorin täglich in den Tiergarten von Buenos Aires zurück.
Dort döst sie auf einem Bankerl und wacht sie auf, sieht sie ein Nilpferd oder einen Löwen und ärgert sich, dass die Tiere nicht protestieren. Ihre Zuneigung zu den eingesperrten Kreaturen befreit zumindest sie ein wenig von ihrem universellen Kater.
Daraus ist „Unbehaust“ entstanden. Der Untertitel verrät nur die halbe Wahrheit: "Was wir Menschen den Tieren antun."
Es sind leichte, eindrucksvolle Texte, die man nicht unbedingt in Schönbrunn lesen muss. Es geht zwar um Kondor und Affe, um Kamel und Kaiman, aber auch um Maria Sonia Christoff selbst: Sie denkt nach, ob sie die laute Großstadt verlassen und zurück nach Patagonien soll, wo sie 1965 geboren wurde. Sie fühlt sich, wie die Zootiere, in der Falle. Die Blitzentscheidung gelingt nicht. Die Autorin wird den Blick der Giraffen aufsetzen müssen: Der genügt, um die – Pardon – Scheiße zu ertragen.
Peter Pisa
KURIER-Wertung: **** von *****
Kommentare