Byrne enttäuscht mit Fahrrad-Tagebuch

Frei nach seinem Hit von 1985 muss man - ungern, äußerst ungern - sagen: David Byrnes "Bicycle Diaries" sind auf dem Weg nach Nirgendwo irgendwo mit einem Patschen stehen geblieben ...
Der in Amerika lebende Schotte radelt seit Anfang der 1980er-Jahre durch New York. Damals war das gar nicht cool, aber es machte ihn frei.
Geht er auf Konzertreise, hat er seither sein Faltrad im Gepäck. So fühlt sich der Musiker dem Leben näher und sieht die Welt, wie er sagt, durchs Panoramafenster.
Und darüber führt
Byrne Buch.
Worüber führt er Buch?
In Buenos Aires fiel ihm beim Radeln auf, dass fast alle Mädchen extrem enge Stretchjeans tragen, und ein großer Labrador bestieg ein traurig aussehendes Weibchen.
In Berlin ließ er sich über den österreichischen Künstler Otto Mühl informieren und notierte eine von dessen Aktionen:
Man bestreiche eine Großmutter mit künstlichem Honig und lasse fünf Kilo Fliegen frei.
In Istanbul dachte er nach, warum überall wunderschöne Städte in graue Steine mit identischen Fenstern verwandelt werden.
In London plauderte er mit einer gewissen Iwona Blazwick, aber es spielt keine Rolle, wenn wir sie hier nicht vorstellen.
Besonders seltsam ist es, wenn David Byrne schreibt, er habe in Australien sein Auto (!) gestoppt, um einer sonnenverbrannten Familie zu helfen, deren Kombi tief im Sand steckte.
"Bicycle Diaries"?
Er bekam dafür übrigens eine Dose Bier, leider nicht seine tasmanische Lieblingsmarke Cascade.
Täuschungen
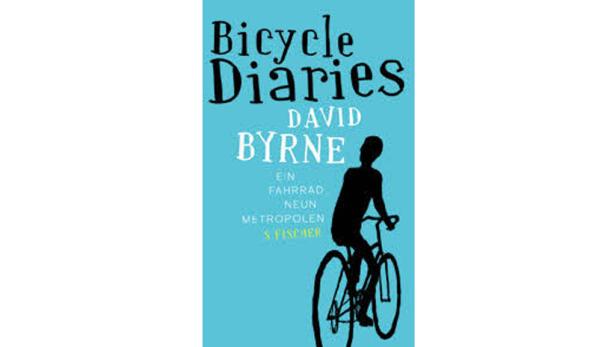
Der heute 59-Jährige ist ja kein schlechter Autor, und er hat gute Gedanken. Allerdings kann man die auch beim Gehen oder im Flugzeug haben.
Wenn
David Byrne über die zwei größten Selbsttäuschungen philosophiert -, dass das Leben einen Sinn hat und dass jeder von uns einzigartig ist, ... dann ist ihm das doch nicht eingeschossen während er in Manila durch einen Park fuhr!
Seine Eindrücke während des Radfahrens kommen viel zu kurz. Im abschließenden Kapitel sagt er uns bloß noch, dass Biker an roten Ampeln und Halteschildern stehen bleiben sollen.
Er empfiehlt zur Diebstahlssicherung ein kurzes Bügelschloss und präsentiert, als Bonus, von ihm designte Fahrradständer in Form einer Gitarre, eines Kaffeehäferls etc.
Traurig ist das.
KURIER-Wertung: *** von *****
William H. Gass - "Der Tunnel"
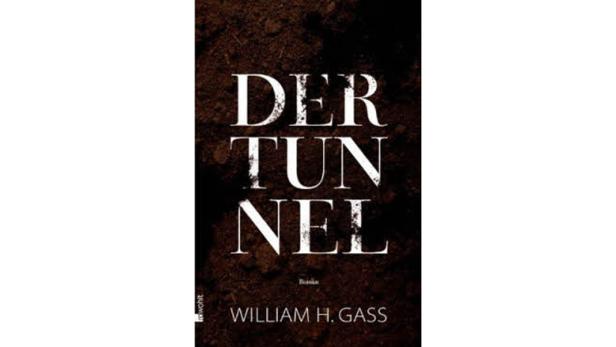
Fast 1100 Seiten hat das Buch. Aber das macht nichts. Vieles ist unverständlich. Aber auch das macht nichts. "Der Tunnel" klingt ... "gut" wäre das falscheste Wort.
Manche haben gesagt, William H. Gass' Lebenswerk klinge nach Arnold Schönberg. Da hat sein deutscher Übersetzer Nikolaus Stingl - der sich drei Mal bekreuzigte, als er nach 13 Monaten mit der Arbeit fertig war - protestiert: Nein, Zwölftonmusik lasse sich nicht auf Literatur übertragen.
Der Rhythmus ist einer, bei dem man mit muss. Die typografischen Raffinessen begeistern. Der Inhalt vom "Tunnel" jedoch ist eine beabsichtigte Zumutung. Erschrecken sollen wir vor uns.
William H. Gass, 1924 in
North Dakota geboren, schrieb über eine Zeitspanne von drei Jahrzehnten am Roman, der in den USA schon vor 16 Jahren erschienen ist:
Es redet bzw. denkt der US-Historiker William Frederick Kohler. Eben beendete er sein Buch "Schuld und Unschuld in Hitlerdeutschland". Er hat das Böse kleiner gemacht und, wie er das nennt, "ein bisschen Zucker auf die Scheiße" gestreut. Nun muss er noch das Vorwort formulieren -, und da kommt sein Leben hoch, seine dicke, riesige Frau, sein kleiner Penis - und der ganze "Faschismus des Herzens" bricht heraus.
Böse Gedanken, dumme, verlogene. Kohler hat "so viel Ressentiment übrig, dass es für eine Flut reicht". Eine dreckig braune Flut. Er kann sogar Limericks über Auschwitz dichten.
Verrückt wird er dabei auch und gräbt im Keller einen Tunnel. Der ist genauso sinnlos wie Kohlers Hass und wie Gass' "Tunnel" und ebenfalls ohne Ausgang. das ist Literatur, die man sich "antun" sollte.
KURIER-Wertung: ***** von *****
Aravind Adiga - "Letzter Mann im Turm"
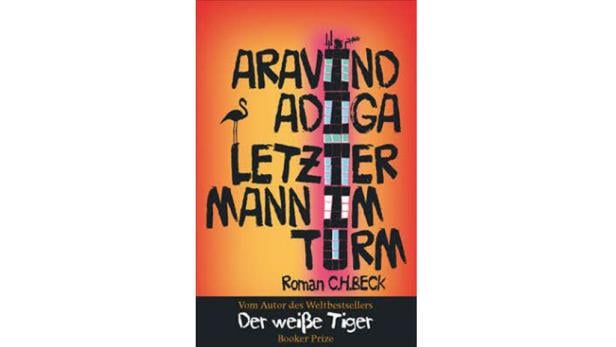
Ein Mensch ist nicht das, was die Nachbarn sagen.
Da steht Yogesh Anantha Murthy fassungslos vor einem Aushang im Treppenhaus. Seine Mitbewohner in der Vishram Society, einem untadeligen Genossenschaftsblock in einem mäßig feinen Stadtteil
Mumbais, haben allerhand Gedanken über ihn zusammengeschrieben. Keine freundlichen. Dabei war der pensionierte Lehrer bis vor Kurzem Respektsperson im Haus. Lehrte die Nachbarskinder das Wirken Shakespeares, verborgte seinen Bibliotheksbestand (verlangte ihn selten zurück) und bekam dafür höchstens ein paar süße Mangos von der lieben Mrs Puri.
Jetzt steht er hier und muss über sich lesen, dass er dem Müllmann nie Trinkgeld gibt. Und dass seine Nachhilfestunden völlig unsinnig sind.
Er denkt: "Lach darüber und ignorier es." Später brennt ihm das Wasser in Augen und Nase. "Ein Mensch ist das, was die Nachbarn über ihn sagen."
Murthy ist allein, seine Frau ist vor Kurzem gestorben, seine Tochter zehn Jahre zuvor. Sie ist aus dem fahrenden Zug gedrängt worden. Ihm bleiben nur Erinnerungen. Und die sind in der Wohnung. Deshalb will er um keinen Preis ausziehen. Die Nachbarn lernen schnell, ihn dafür zu hassen. Ein Spekulant will hier, in dem Viertel, das eben noch am Rande der Slums liegt, morgen schon zu den feinen Gegenden zählen soll, neu bauen. Dafür will er die Mieter rauskaufen. Nur, wenn alle unterschreiben, gibt es Geld. Murthy weigert sich. Er ist "Letzter Mann im Turm" .
Schon im Erstlingswerk "Der weiße Tiger" (Booker-Preis 2008) übte Aravind Adiga Kritik an seiner Heimat Indien. Jetzt legt er mit zeitgeistiger Sezierung der menschlichen Gier nach.
Passt auch zur Bankenkrise. - Barbara Mader
KURIER-Wertung: **** von *****
Kommentare