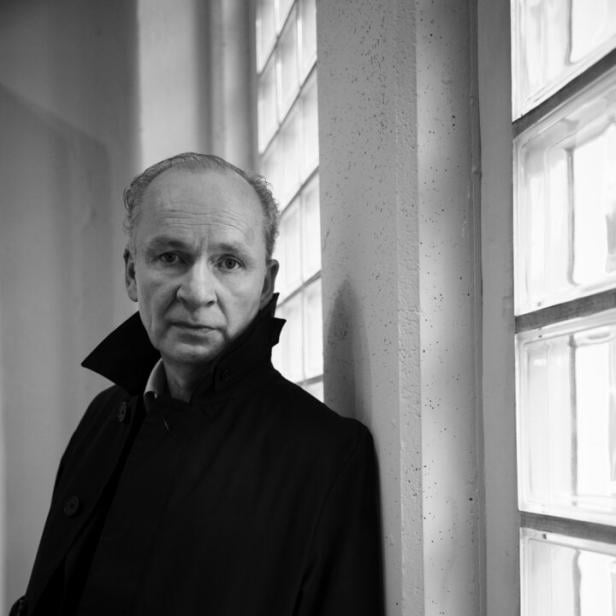
Ferdinand von Schirach: "Es ist wie im wilden Westen"
Schriftstellergröße Ferdinand von Schirach verurteilt soziale Medien, die KI stelle uns vor große Entscheidungen. Ein Gespräch über unsere Zukunft zwischen Macht und Moral.
Seine Worte sind bedacht, seine Stimme ist sanft. Doch was er sagt, könnte stärker nicht sein. Ferdinand von Schirach (61), dessen Werke (u. a. „Strafe“, „Kaffee und Zigaretten“, neu: „Der stille Freund“) sich in mehr als 40 Ländern millionenfach verkauft haben und dessen Theaterstücke (etwa „Gott“, „Terror“) auch Jahre nach ihrer Uraufführung Nachhall finden, gilt als eine der bedeutendsten literarischen Stimmen Europas. Im Interview spannt er den Bogen von Gerechtigkeit von früher bis hin zu Strafen von heute.
KURIER freizeit: Wir sitzen hier im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg, in der Monarchie war dies auch offizieller Thronsaal, hier hat außerdem Napoleon um die Hand der Kaisertochter Marie-Louise angehalten. Es ist also ein Raum, der Geschichte atmet und mit Macht zu tun hat. Wenn Sie eine Figur aus der Zeit von damals ins Jetzt bringen könnten und über moderne Gerechtigkeit zu sprechen: Wer wäre das?
Ferdinand von Schirach: Voltaire. Ich finde ihn immer noch eine der interessanten Personen, er wird leider nicht mehr sehr viel gelesen, aber er ist großartig.
Worüber würden Sie mit ihm sprechen?
Über das, was im Moment das Wichtigste ist: Toleranz. Wir denken, wir sind furchtbar tolerant und in Wirklichkeit sind wir es nicht. Wir müssen lernen, dass wir auch die absurde Meinung aushalten. Voltaire hat das als einer der Ersten gesehen, er sagte, wir müssen tolerant sein, sonst ist alles andere, was wir machen, nichts wert. In Amerika wurde kürzlich ein berühmter Moderator von seinem Sender entlassen, auf Wunsch von Donald Trump. Wenn man es nicht mehr aushält, dass ein Moderator oder Komiker Witze über einen macht, führt uns das ins Verderben.
Ist die Welt intoleranter geworden?
Mit Sicherheit.
Und warum?
Sie wurde toleranter durch die Trennung von Kirche und Staat. In Ländern, in denen das nicht der Fall ist, ist die Intoleranz am größten. Monotheistische Religionen sind letztlich immer fundamentalistisch, weil sie ja nur an einen Gott glauben. Bei den Griechen und Römern, die Tausende von Göttern hatten, waren Religionen hingegen tolerant. Das war also sehr viel freier.
Erst durch Trennung von Kirche und Staat im Christentum war die Aufklärung überhaupt möglich. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich am tolerantesten. Aber wir verlieren es wieder und man muss dauernd darum kämpfen.
Die Welt hat viel zu viele Anwälte. Und es ist auch nicht schlau, die Weltherrschaft den Anwälten zu überlassen.
Beim Blick in die sozialen Medien, wo die Ränder lauter werden und die Mitte leiser wird, passiert aber oft das Gegenteil von Toleranz. Wie geht das zusammen?
Die ursprüngliche Idee der sozialen Medien war sinnvoll: dass wir uns unterhalten, Meinungen austauschen, um das Richtige ringen. Mittlerweile sind die sozialen Medien eine Jauchegrube, die in den größten Teilen vollkommen schrecklich ist. Das liegt unter anderem an den Algorithmen, mit denen die programmiert worden sind. Der Hass ist dabei immer das Lauteste und umso mehr Hass es gibt, umso mehr wird er verstärkt.
Wir wissen heute von den sozialen Medien, dass sie die größte Gefährdung der Demokratie sind. Man kann nachweisen, dass der Brexit ohne die sozialen Medien nicht stattgefunden hätte. Donald Trump wäre nicht da, wo er heute ist. Regierungen wurden ohne Presse möglich, der Präsident oder ein Regierungsmitglied verkündet seine Thesen, ohne dass klassische Medien dazwischengeschaltet werden.
Wir wissen heute sogar, dass sich zum ersten Mal in der Geschichte mehr Amerikaner über die sozialen Medien informieren als über die klassische Presse und das führt ins Unglück.
Wie groß ist die Strafe des digitalen Prangers inzwischen geworden?
Otto Waalkes sagte neulich, das mit dem Shitstorm im Internet sei nicht so schlimm, der sei ja nur im Internet. Klug eigentlich. Aber tatsächlich ist es so, dass die Anfeindungen in den sozialen Medien heute bis hin zu Suiziden von jungen Menschen führt. Diese zu große Wirkung von allem, was man tut, hat keine Vorteile, sondern fast nur Nachteile.
Das, was wir wollten, war, dass sich Menschen, die an unterschiedlichen Orten der Erde leben, miteinander unterhalten können. Und dass die Wissenschaft sich darüber austauschen kann. Das ist alles längst vorbei.
Was können wir jetzt tun, welche Gesetze bräuchte es und kann man solche überhaupt noch festlegen?
Gesetze kann man immer festlegen, das Problem ist, dass es zwei Seiten hat. Der Gesetzgeber darf nicht zensieren, da kommt man in Teufels Küche. Auf der anderen Seite muss man nicht alles erdulden, was passiert. Es ist ein bisschen wie im Wilden Westen. Das Internet und die sozialen Medien sind am Anfang eine rechtlich ungeordnete Masse gewesen. Das Recht durchdringt sie nach und nach, aber das geht langsam.
Im Grunde genommen muss man es fertigbringen, dass das digitale Ich genauso behandelt wird wie das physische Ich. Es müssen sich also dieselben Mechanismen, die sich über lange Zeit bewährt haben, im Internet etablieren. Das ist unendlich schwierig, weil sich alle zwei Minuten alles ändert. Aber es ist nun mal die Aufgabe des Rechts, auch das zu ordnen.
Viel schwieriger wird es mit der KI. Das Merkwürdige der KI ist, dass Sie auf der einen Seite etwas eingeben und auf der anderen Seite eine Ausgabe bekommen – und niemand weiß, was dazwischen passiert. Das ist teuflisch, das ist ein schwarzer Block und ihn rechtlich zu ordnen ist wesentlich schwieriger.
Dabei wird KI ja auch bereits im Rechtssystem selbst angewendet, etwa in Masseverfahren oder bei besonders schwierigen Abwägungen. Wo hört die Effizienz auf, wo fängt der Kontrollverlust an?
Es muss immer so sein, dass die letzte Kontrolle ein Mensch hat. Die KI soll Vorschläge machen und Menschen müssen diese auswerten. Extremstes Beispiel sind Drohnen, die aufgrund von Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wer Terrorist ist und wer nicht. Das hat man gemacht und es ging schief: Eine Hochzeitsgesellschaft im Jemen wurde getötet von einer Drohne, die eine Wahrscheinlichkeit errechnet hat. Es waren aber keine Terroristen.
Im Rechtssystem gibt es aber unendlich viele Verfahren, die mit einer KI besser gelöst werden können. Etwa bei Überlegungen zur Verteilung der Sozialhilfe, bei Verkehrsunfällen, auch bei den meisten Zivilverfahren. Ich würde einem 20-Jährigen sagen: Werde auf keinen Fall Steuerberater, weil das wird etwas sein, was eine KI am Schluss besser kann.

Ferdinand von Schirach im Interview mit Marlene Auer bei KURIER freizeit.live in der Wiener Hofburg
©kurier/Martina BergerWürden Sie raten, Anwalt zu werden?
Auf gar keinen Fall. Die Welt hat viel zu viele Anwälte. Und es ist auch nicht schlau, die Weltherrschaft den Anwälten zu überlassen. Betrachten wir die Probleme, die alle europäischen Staaten mittlerweile mit der Migration haben, und worüber in unzähligen Talkshows diskutiert wird, ist man inzwischen glücklich, wenn es mal einen gibt, der dabei sagt: Ja, aber wir haben doch die Gesetze gemacht und dann lassen Sie uns die doch verändern. Der Jurist richtet sich nur nach den Gesetzen, aber die Politik verändert sie.
Sie sind vom Anwalt zum Autor geworden. Brauchen wir gerade in diesen digitalen Zeiten die menschliche Kreativität demnach mehr denn je?
Klar! Ich habe die KI ausprobiert und die Ergebnisse sind albern. Ich gab etwa einmal ein: Schreib mir eine Geschichte im Stil von Schirach, da kommt wirklich Unsinn heraus. Aber das wird besser werden und es wird viele Groschenromane geben, die auch ganz gut sein werden. Die Frage ist, ob wir das lesen sollen oder ob wir wollen, dass ein Mensch das schreibt. Im Moment werden auch kleine Geräte entwickelt, mit denen die KI Emotionen und Empfindungen erkennen lernt.
Sie haben keine Profile in den sozialen Medien. Wie recherchieren Sie dann zu den Entwicklungen, die dort stattfinden?
Vieles kann man auch ohne Profil lesen. Und es gibt Studien und NGOs, die dort umfangreich recherchieren.
Zu den dort publizierten Postings bilden sich schnell Meinungen in Mehrheiten, haben diese Mehrheiten Recht?
Wir wissen aus der Geschichte, dass Mehrheiten oft nicht Recht hatten. Die Mehrheit der Menschen glaubte über Jahrtausende, dass sich die Sonne um die Erde dreht. Und bei den Reaktionen in den sozialen Medien spielt offenbar das limbische System oft die größte Rolle. Also die unmittelbare Reaktion auf ein Ereignis. Das ist nicht sinnvoll. Sinnvoll ist, man hört sich etwas an, tritt einen Schritt zurück, denkt nach, und wenn man glaubt, das verstanden zu haben, kann man sich äußern.
Nun haben Sie aber ein Theaterstück geschrieben, in dem das Publikum in der Mehrheit das Urteil fällen soll. Wenn Mehrheiten nicht immer Recht haben: Wie geht das dann zusammen?
Wie Sie richtig sagen: Das war ein Theaterstück und kein wirkliches Gerichtsverfahren. Es ging um Aufmerksamkeit. Menschen hören genauer zu, wenn sie die Verantwortung tragen. Deswegen war das in gewisser Weise auch ein Trick.
In Ihrem neuen Buch „Der stille Freund“ geht es in 14 Erzählungen über Wahrheit und Wirklichkeit, auch über Triumph und Tod. Ein Kapitel handelt vom erfolgreichen deutschen Tennisspieler Gottfried von Cramm. Er meldete bei einem legendären Daviscup-Match einen Regelverstoß, das kostete ihm den Sieg, Deutschland flog aus dem Turnier.
Ja, er behauptete, eine Faser des Balles habe seinen Schläger berührt. Niemand hat das gehört. Nicht die Schiedsrichter, nicht die Zuschauer, aber er bestand drauf und Deutschland flog aus dem Endspiel.
Er wurde dann als Vaterlandsverräter beschimpft. Doch er trat entgegen des Drucks für die Fairness ein. Was kann man aus dieser Erzählung an Lehren ziehen?
Das Interessante daran ist seine Idee, sich anständig zu verhalten, auch wenn es keiner sieht und keiner hört. Das ist Anstand und dann wird es auch allgemein ein kleines bisschen besser. Wir haben nur sehr kurze Zeit in dieser Welt. Es sind nur ein paar Jahre, danach versinken wir wieder in der Dunkelheit. Wir sollten versuchen, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als wir sie bekommen haben. Das ist Gottfried von Cramm meines Erachtens gelungen.
Das Merkwürdige der KI ist, dass Sie auf der einen Seite etwas eingeben und auf der anderen Seite eine Ausgabe bekommen – und niemand weiß, was dazwischen passiert. Das ist teuflisch, das ist ein schwarzer Block und ihn rechtlich zu ordnen ist wesentlich schwieriger.
Manche Ihrer Erzählungen sind geprägt von besonderer und durchdringender Atmosphäre, etwa auch das Kapitel zur Scheinamputation. Müssen Szenen und auch Theaterstücke in der lauten Welt von heute besonders laut sein, um gehört zu werden?
Ich glaube, dass Lautstärke keine gute Idee ist. Wenn man brüllt, wird man gehört – aber nicht auf Dauer. Wenn man leise spricht und das Richtige sagt, wird man immer von den richtigen Leuten gehört. Es gibt Sprachen, die nicht lügen können, Mathematik etwa. Es ist auch nicht möglich in der Musik zu lügen. Aber bei unserer Sprache ist alles möglich. Sie können sagen, die Erde ist flach und es schnürt Ihnen nicht die Kehle zu. Und nun geht es darum, nicht laut zu brüllen, die Erde ist in Wirklichkeit eine Kugel, sondern zu beschreiben, warum sie eine Kugel ist.
Sprache verändert sich, Texte werden kürzer und im Handy auch durch Zeichen oder Symbole ersetzt. Ist diese Verknappung eine Gefahr?
Sprache ist lebendig und Sprache muss sich verändern. Es ist noch nicht so lange her, dass plötzlich alle über das Binnen-I zu sprechen begannen, ob es da ein Sternchen braucht oder einen besonderen Laut. Das ist natürlich alles Unsinn und es wird wenig davon übrig bleiben. Aber es ist gut, dass es die Diskussion gab.
Vor 200 Jahren gab es schon einmal eine solche Debatte. Da ging es darum, dass man aus der deutschen Sprache die Fremdwörter tilgen wollte. Die Nase etwa war als Fremdwort klassifiziert worden und es sollte umbenannt werden in Gesichtserker. Es wurde wirklich versucht das durchzusetzen, das funktioniert natürlich nicht. Gefährlich wird es aber, wenn Sprachen verschwinden und wenn eine Sprache zu dominant wird. Das verkürzt die anderen Sprachen. Jede Sprache ist eine Welt. Und ich finde auch die Emoji-Sprache lustig. Ich kann nichts damit anfangen, aber ich finde sie originell.
Schicken Sie Emojis?
Tatsächlich habe ich noch nie ein Emoji geschickt, weil ich nicht weiß, wo das auf dem Handy ist. Es hat mir jemand einmal gezeigt, aber ich habe sie dann nicht mehr gefunden. Ich würde nur noch Emojis verschicken, wenn ich es könnte.
Sie schauen auch Serien, etwa „The Young Pope“, wie ich in meinen Recherchen erfahren habe. Was begeistert Sie daran?
Der junge Papst wird gespielt von Jude Law. Er ist dabei überirdisch schön und die erste Szene zeigt, wie er im Bett liegt und überlegt, was er mit seiner ersten Rede auf dem Petersplatz macht. Das Großartige an dieser Serie ist: Sie glauben immer, sie wissen, was passiert. Und es passiert das Gegenteil. Und plötzlich beginnen Sie darüber nachzudenken, was Kirche sein kann. Ganz anders als im Film Konklave, den alle so großartig finden. Erstens ist „The Young Pope“ viel schöner und zweitens viel intelligenter.
Sehr vielen Menschen gibt die Kirche Halt. Ihnen auch?
Überhaupt nicht.
Was gibt Ihnen dann Halt?
In dieser Hinsicht bin ich durch und durch Römer, ich mag die vielen Götter. Halt gibt mir im geistesgeschichtlichen Sinne die Aufklärung. Ich war zehn Jahre lang bei den Jesuiten und habe zehn Jahre lang jeden Morgen eine Messe gehört, das reicht für ein ganzes Leben.
Und wie sieht denn heute ein typischer Tag im Leben von Ferdinand von Schirach aus?
Von außen langweilig. Ich stehe relativ früh auf und schreibe, dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe noch ein bisschen, dann gehe ich ins Kaffeehaus und frühstücke und treffe dort manchmal Leute, entweder verabredet oder zufällig.
Schreiben Sie dort auch?
Nein, manchmal mache ich mir Notizen, aber wirklich schreiben tue ich meistens zu Hause. Und dann mache ich Mittagsschlaf, Sie sehen, ich schlafe doch sehr viel, wenn ich das so überlege. Und nach dem Mittagsschlaf mache ich dieses grauenhafte Bürozeug, das wir alle machen müssen, und dann gehe ich zum Abendessen. Also es ist wirklich ein unendlich langweiliger Tag. Und das Schöne ist, jeder Tag ist gleich.
Was fällt Ihnen beim Schreiben leichter: erlebte oder fiktive Fälle?
Thomas Mann hat einmal gesagt, er hätte nie in seinem Leben etwas erfunden und das unterschreibe ich. Ich denke mir das nicht aus, was ich mache, ist, verschiedene Fälle zusammenzusetzen. Und es ist ja alles interessanter als man selbst. Jedes Gespräch ist aufregender und jeder Mensch hat eine Geschichte, die er erzählen kann und Sie müssen nur danach fragen. Dann haben Sie genügend Fälle und müssen sich nicht irgendwelchen Unsinn ausdenken.
Also, schauen Sie mal, die Dame dort, die trifft nachher noch ihren Liebhaber. Ihr Mann weiß nichts davon. Und der Herr dort hinten hat heute Morgen etwas wirklich Schreckliches getan. Wenn Sie wüssten. Ich will damit sagen, man bekommt die Geschichten frei Haus.
Sie haben 20 Jahre lang als Strafverteidiger gearbeitet und Sie sagen, Straftäter kann jeder werden. Wirklich jeder?
Ja. Der Herr dort … Nein, es ist tatsächlich so: Die meisten der Straftaten, in denen ich verteidigt habe, waren Delikte, von denen die Menschen morgens nicht gewusst haben, dass sie diese jetzt begehen. Sie werden aus einer bestimmten Situation heraus geboren, oft aus Situationen, die schon ganz lange dauern.
Etwa bei jahrelanger Unterdrückung in Beziehungen, bei Demütigungen, schon wenn man dem anderen das Frühstücksei bringt. Und irgendwann, Sie wissen auch nicht genau warum, nehmen Sie das Nudelholz und erschlagen den anderen. Sie hätten aber vor vier Monaten noch nicht gedacht, dass Sie dazu in der Lage sind.
Es ist also nicht so, dass es ein Verbrecher-Gen gibt. Natürlich gibt es dauerhafte Delikte wie ständige Betrügereien, aber die existenziellen Themen werden aus Situationen heraus geboren. Ich jedenfalls habe nie jemanden getroffen, der morgens aufsteht und sagt: Heute begehe ich einen Mord, das wird toll.
Deshalb ist es aber nicht weniger schlimm.
Natürlich nicht, wenn es am Schluss einen Toten gibt, ist das immer schlimm. Im Mittelalter gab es die Spiegelstrafe. Wir haben nicht gefragt, warum jemand etwas tut. Wenn Sie einen Apfel gestohlen haben, dann wurde Ihnen die Hand abgehackt. Und es war egal, ob Sie den Apfel gestohlen haben, weil Sie Hunger hatten oder weil Sie Äpfel schön finden oder weil Sie einen Knall haben und gedacht haben, Sie sind selbst ein Apfel. Das Motiv hat uns nicht interessiert. Das nannte man Tatstrafrecht, man wurde ausschließlich nach der Tat bestraft.
Ehebrecher wurden aufeinander gepfählt, einem Mann, der einen Meineid geschworen hat, wurde die Zunge herausgeschnitten. Es waren sehr extreme Strafen. Heute aber interessiert uns die Schuld, wie kam es zu der Tat, und das wird dann rechtlich heute eben anders gewertet. Das nennt man Schuldstrafrecht.
Was wäre persönlich Ihre größte Strafe?
Dass ich die Menschen verliere, die ich liebe.
Und was wäre Ihr größtes Glück?
Das ist eine philosophische Frage, weil Glück nur eine Ansammlung von Momenten ist. Glück ist kein dauerhafter Zustand, sondern man erfährt es in Spitzen. Mir geht es um Gelassenheit. Das ist mein Lebensziel.
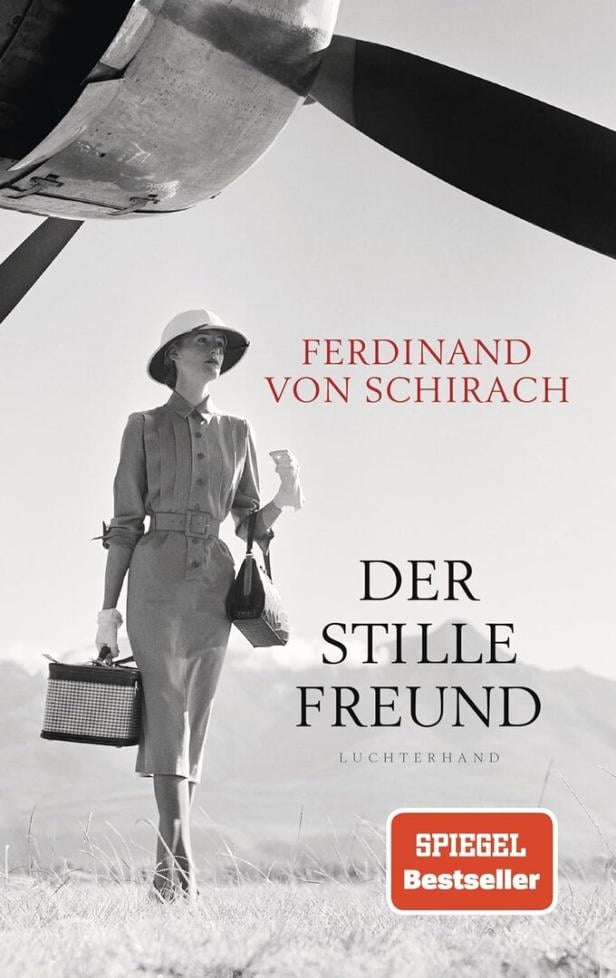
Buchtipp: „Der stille Freund“, von Ferdinand von Schirach
Erschienen im August 2025, 176 Seiten, Verlag Penguin Random House
©Verlag

Kommentare