Ebola: Erstmals wird Infizierter nach Europa geflogen
Die spanische Regierung lässt einen mit dem Ebola-Virus infizierten Staatsbürger aus Westafrika in sein Heimatland zurückbringen. Eine Maschine der Luftwaffe sollte am Mittwoch von Madrid nach Liberia starten, um den aus Spanien stammenden Geistlichen abzuholen. Bei dem Transport würden die strengsten Sicherheits- und Quarantäne-Vorkehrungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingehalten.
Spanien ist damit nach den USA der zweite westliche Staat, der bei der aktuellen Epidemie in Westafrika einen mit Ebola infizierten Staatsbürger aufnimmt. Der 75-jährige Geistliche Miguel Pajares hatte in Monrovia in einem mittlerweile geschlossenen Krankenhaus gearbeitet. Dort hatte der Spanier den später an Ebola gestorbenen Direktor gepflegt. Am Montag ergab ein Test, dass er ebenfalls mit dem Virus infiziert wurde.
Petition
Beamte der Madrider Ministerien für Gesundheit, Verteidigung und Inneres beschlossen, den aus der Gegend von Toledo stammenden Geistlichen nach Spanien zurückzubringen. Zuvor hatten zehntausende Spanier haben von der Regierung in Madrid die sofortige Rückkehr eines spanischen Geistlichen gefordert, der sich in Liberia mit dem Ebola-Virus infiziert hat. Die entsprechende Internetpetition war am Dienstagabend bereits von mehr als 75.000 Menschen unterstützt worden.
Die Reaktionen in den USA waren vielfach anders ausgefallen: Dort hatten sich in Foren und anderen Beiträgen etliche Menschen aus Angst vor Ansteckung gegen eine Rückkehr von infizierten Amerikanern ausgesprochen.
"Im Stich gelassen"
Der 75-jährige Johanniter Miguel Pajares, der seit acht Jahren in Liberia für eine Nichtregierungsorganisation tätig ist, sagte der Nachrichtenagentur EFE vor dem Beschluss, er fühle sich im Stich gelassen. Ein Test ergab am Montag, dass er Ebola hat. "Ich würde gern nach Spanien, weil wir hier sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Man hilft uns nicht."
Die Situation im Krankenhaus sei sehr schlimm, ließ die spanische Nichtregierungsorganisation "Juan Ciudad" wissen. Neben dem Geistlichen seien auch zwei Missionarinnen infiziert. Insgesamt seien seit dem 1. August sechs Missionare unter Quarantäne gestellt.
Experten reagieren zurückhaltend auf Heil-Serum
Nach der offenbar erfolgreichen Behandlung eines an Ebola erkrankten US-Arztes reagieren Experten zurückhaltend auf das experimentelle Serum ZMapp. "Ich denke, wir sollten sehr vorsichtig sein und keine Schlüsse über die Rolle von ZMapp ziehen, bis wir mehr Details erfahren", sagte der US-Mikrobiologe Thomas Geisbert von der University of Texas in Galveston, einer der führenden Ebola-Forscher.
Brantly könne auch zu jenen rund 40 Prozent der Patienten gehören, die die Erkrankung ohne Behandlung überleben. "Ich denke, wir benötigen mehr Daten, um eine definitive Aussage zu treffen", sagte Geisbert der dpa.
Zweifel an ZMapp
Mit dem Antikörper-basierten Mittel ZMapp war der US-Arzt Kent Brantly behandelt worden, der sich in Liberia mit Ebola infiziert hatte. Zuvor war das Mittel lediglich an Affen getestet worden. Nach der Verabreichung habe sich Brantlys Zustand binnen einer Stunde gebessert, hatte der Sender CNN berichtet. Geisbert zweifelte das an. "Es ist nicht realistisch zu erwarten, dass ernste klinische Symptome in einer Stunde verschwinden", betonte er. "Das passiert nur in Filmen."
"Wir müssen sehr vorsichtig sein", sagte auch der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. "Wir brauchen noch mehr Daten. Ich würde nicht sagen, dass das Serum die Lösung ist, um alle Ebola-Patienten zu retten. Vielleicht kann es jedoch unterstützend sein."
Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München schließt Nebenwirkungen nicht aus. "ZMapp ist bisher rein experimentell", sagte er. Das Immunsystem könne stark auf die Antikörper reagieren. "Da es bislang noch keine Daten oder Tests an Menschen gibt, sind die Aussagen über Nebenwirkungen von ZMapp schwierig. Theoretisch reicht die Bandbreite von leichtem Fieber bis hin zu Schockzuständen."
ZMapp beruht auf dem Wirkstoff MB-003, der unter anderem von Mitarbeitern der US-Armee mitentwickelt und getestet wurde. Dieser besteht aus Antikörpern, die an die Viren binden und es dem Immunsystem ermöglichen sollen, infizierte Zellen zu eliminieren. Produziert werden die Antikörper in Tabakpflanzen.
Weltbank: 200 Mio. Dollar Hilfe gegen Ebola
Gleichzeitig will die Weltbank Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie ein Notprogramm in Höhe von 200 Millionen Dollar (knapp 150 Millionen Euro) auflegen. Die Hilfe diene kurzfristig zur Finanzierung von Fachpersonal, Ausrüstung und Vorbeugemaßnahmen in den am meisten betroffenen Staaten Liberia, Guinea und Sierra Leone, teilte Weltbankpräsident Jim Yong Kim am Montag mit. Gleichzeitig solle es die Länder aber auch wirtschaftlich unterstützen. Von der Afrikanischen Entwicklungsbank sollen weitere 60 Millionen Dollar fließen, wie Mitarbeiter berichteten.
Nach Angaben Jim Yong Kims muss das Programm noch vom Verwaltungsrat abgesegnet werden, dies dürfte noch Ende der Woche geschehen. Rasche Maßnahmen seien dringend geboten, mahnte der Weltbankpräsident, der selbst Experte für Infektionskrankheiten ist. Mit Sorge verfolge er, wie die Ausbreitung des tödlichen Virus zum Zusammenbruch der "vorher schon schwachen Gesundheitssysteme" in allen drei Staaten führe. Sollte es nicht gelingen, den Vormarsch der Seuche zu stoppen, seien zahlreiche weitere Leben in Gefahr.
Abstimmung mit WHO
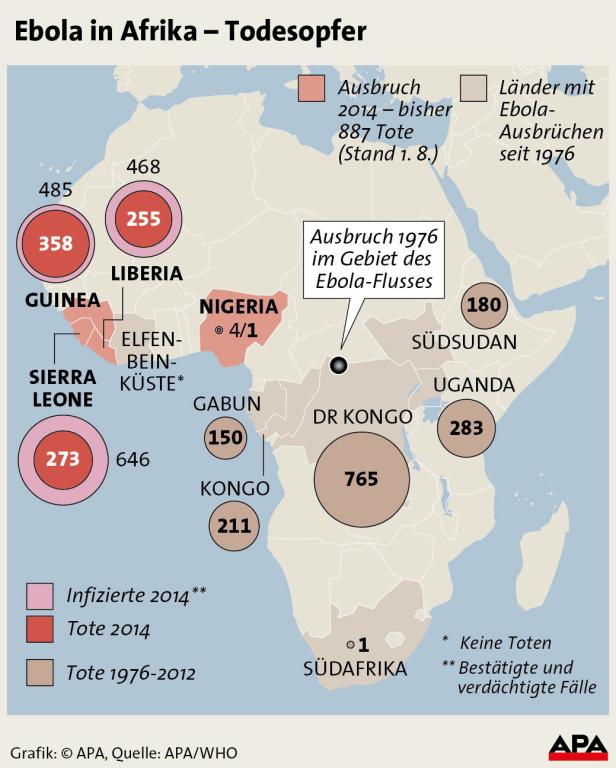
Ebola-Patient in den USA

Das Ebola-Virus löst hämorrhagisches Fieber aus, das in vielen Fällen zum Tod führt. Medikamente dagegen gibt es nicht, doch steigert eine frühzeitige Behandlung die Überlebenschancen.
Fragen und Antworten rund um das tödliche Virus finden Sie hier.
Wie gering das Risiko der "Einschleppung" des Ebola-Virus nach Österreich ist, ergibt sich unter anderem aus dem marginalen Reiseverkehr zwischen Österreich und Ländern wie Sierra Leone, oder Liberia. "Ich habe in 30 Jahren Tätigkeit als Reise- und Tropenmediziner keinen einzigen 'touristisch' Reisenden betreut, der in Liberia oder Sierra Leone war", sagte der Wiener Spezialist Herwig Kollaritsch
Dafür gibt es mehrere Gründe. "Sierra Leone war ja zum Beispiel lange ein Bürgerkriegsland. Das war eine 'No-Go-Area für Touristen", erklärte der Tropen- und Reisemediziner am Dienstag gegenüber der APA. Ähnliches hätte viele Jahre lang auch für Liberia gegolten. Außerdem seien die westafrikanischen Staaten, die derzeit von dem Ebola-Ausbruch betroffen sind, keineswegs reich an Touristenattraktionen.
Damit schränkt sich der Reiseverkehr - Direkt-Flugverbindungen zwischen Liberia, Sierra Leone, Nigeria und Guinea nach Österreich gibt es nicht - auf Angehörige von Hilfsorganisationen, Regierungsvertreter und ebenfalls wenige Business-Reisende ein. Diese aber sind über allfällige Infektionsrisiken informiert.
Eindeutig negiert wird von Experten auch die Gefahr der Einschleppung des Ebola-Virus durch Flüchtlinge. "Wer an Ebola erkrankt, kann nicht mehr herumlaufen", führte Kollaritsch die tragische Seite für die Betroffenen an. Flüchtlinge aus den von dem Ausbruch derzeit betroffenen Ländern kämen nicht mit dem Flugzeug in die westliche Welt. Und bis sie sich auf Landweg durchgekämpft hätten, sei die Inkubationszeit längst vorbei.
Europas Spezialisten gehen auch auf technischer Seite in Kooperation vor. "Man kann das Virus direkt im Blut von Infizierten nachweisen", sagte am Dienstag Stephan Aberle vom Department für Virologie der MedUni Wien. Der Virusnachweis bzw. die Abklärung eines Verdachtsfalls durch die Laboruntersuchung würde in Hamburg am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erfolgen. Dort wurden die entsprechenden Testansätze unter Benutzung der Polymerase-Chain-Reaction (PCR) etabliert. Das System basiert auf der Vermehrung der Erbinformation des Virus dessen spezifischen Nachweis binnen kurzer Zeit. Erst in der Folge könnte auch ein Antikörpertest durchgeführt werden.
Kommentare