
Andrea Sawatzki: "Ich habe dabei gelernt, zu überleben"
Neuer Film, neuer Roman: Andrea Sawatzki über ihre schwere Kindheit, das Älterwerden und den Skandal Pflegenotstand.
Heiter und wolkig. So könnte man die kulturelle Stimmungslage bei Andrea Sawatzki skizzieren. Das liegt an ihren zwei neuen Arbeiten, die gegensätzlicher kaum sein könnten: ein berührender Roman und eine launige Komödie. „Biarritz“ heißt ihr Buch, Sawatzki ist nicht nur Schauspielstar, bekannt etwa als „Tatort“-Kommissarin in Frankfurt, sondern auch Bestsellerautorin. Thema: ihre Kindheit.
Autofiktional erzählte sie daraus und vom demenzkranken Vater bereits in „Brunnenstraße“, nun schreibt sie über das Verhältnis zu ihrer Mutter, zwar fiktional, jedoch stark von ihrem eigenen Leben geprägt. Die Mutter, Emmi, lebt im Altersheim und hat das Sprechen eingestellt, die Tochter zermürbt das Warum darüber und beschließt, eine letzte große Reise mit ihr zu unternehmen. Es geht um Pflege, Demenz, eine komplexe Kindheit – starker Stoff.
Ganz anders dagegen ihre neue Komödie: Die Abenteuer der Familie Bundschuh sind eine beliebte Fernsehreihe, die zum Großteil auf Sawatzkis Romanen basiert. Der neunte Teil nennt sich „Wir machen Camping“ (1.9., 20.15 Uhr, ZDF): Ein Kurzurlaub soll die Ehe von Gundula auffrischen, doch statt im Luxushotel landet man im Wohnmobil – mitsamt der ganzen Sippe. Ein witziges, kurzweiliges Lustspiel mit Darstellern in Hochform. Im Interview wollen wir beide Arbeiten zum Thema machen.
Ihr Roman „Brunnenstraße“ handelte von Ihrem demenzkranken Vater, jetzt schreiben Sie mit autobiografischen Grundzügen über die Beziehung zu Ihrer Mutter. Hat das Thema lange in Ihnen gearbeitet?
Ja, viele Jahre. Den Ausschlag gaben aber meine Leserinnen und Leser. Viele haben mich nach der „Brunnenstraße“ gefragt, was denn mit der Mutter in der Geschichte sei, der Gedanke kam auf, sie hätte dem Vater nicht zur Seite gestanden. Das konnte ich so nicht gelten lassen.
Wie war es tatsächlich?
Meine Mutter hat alles gegeben, was in ihren Möglichkeiten stand, das wollte ich richtigstellen. Wenn auch widerstrebend: Ich habe mich wirklich gesträubt, noch so ein persönliches Buch zu schreiben. Doch das Thema ist wichtig: Ich habe viele Gespräche mit Menschen geführt, die Demenz- oder Alzheimerkranke pflegen, die Schuld empfinden und das Gefühl, sie machen nicht genug.

Schreiben als Therapie: „Mit dem Roman war es mir möglich, den Groll auf meine Mutter loszuwerden“, so Andrea Sawatzki
©Valeria MitelmanAuch die Mutter ist dement, spricht nicht mehr. Gleichzeitig geht es um die Beziehung zwischen Tochter und Mutter, Schmerz und Schuld.
Auch der neue Roman handelt von der Krankheit Demenz, aber auch von Schuldgefühlen, und dann ist da noch der Groll, den man als Kind oft entwickelt, wenn die Eltern sich entziehen und man nicht über das sprechen konnte, was einem wichtig gewesen wäre.
Ihr Vater war mit einer anderen Frau verheiratet, nachdem diese Selbstmord beging, kamen Ihre Eltern wieder zusammen. Wollten Sie Ihrer Mutter mit dem Schreiben näherkommen, sie besser verstehen lernen?
Ich wollte eine Liebeserklärung an meine Mutter schreiben. Das war der Grundgedanke. Während des Schreibens habe ich dann gemerkt, dass in mir immer noch ein Groll auf sie schlummert. Dass sie sich einfach so davongemacht hat – obwohl sie ja nichts dafür konnte. Ich habe zehnmal von Neuem begonnen, das Buch zu schreiben und insgesamt drei Jahre dafür gebraucht.
Wie war der Schreibprozess für Sie?
Das Schreiben hat mich dazu gebracht, nochmal ihr Leben zu beleuchten. Mich in sie hineinzuversetzen, in die Zeit als sie alleinerziehende Mutter war, wie sie Geld verdienen musste für uns, später die Enttäuschungen erleben musste, als wir zu meinem Vater gezogen sind. Im Grunde war ihr Leben eine Anhäufung von Enttäuschungen. Diese Generation war oft zu einem Schweigen verurteilt. Sie war auch zu einem Schweigen erzogen worden. Deswegen war es ihr nicht möglich, auf mich einzugehen.
Konnten Sie Ihrer Mutter verzeihen?
Ich bin sehr glücklich, dass ich diesem Kreislauf des Schweigens entkommen konnte. In Form dieses Buches, aber auch im Umgang mit meinen Söhnen. Meine Mutter konnte das nicht, ihre Gefühle aussprechen. Mit dem Roman war es mir möglich, den Groll auf meine Mutter loszuwerden. Beim Versuch, sie zu verstehen wurde vieles deutlicher und leichter.
Wenn es so viel aufzuarbeiten gibt, wird man damit wahrscheinlich nie richtig fertig, oder?
Die Bilder und Erinnerungen an meine Mutter bleiben. Was mich glücklich stimmt, seitdem das Buch fertig ist: Wenn ich etwas Schönes erlebe, denke ich – „das muss ich Mama erzählen.“ Das war lange Zeit nicht der Fall. Für mich ist es ein Zeichen, dass die Liebe zurückgekehrt ist. Deswegen ist das Buch so wichtig für mich.
Es waren harte Jahre, aber ich habe dabei auch gelernt, zu überleben. So bin ich erzogen worden: Probleme lösen sich nicht von selbst, man muss schon anpacken.
Sie haben drei Jahre an „Biarritz“ geschrieben. Mussten Sie manchmal aufhören, weil Ihnen die Arbeit daran zu schwergefallen ist?
Im Gegenteil. Trotzdem musste ich beim Korrekturlesen bei manchen Passagen schlucken. Auch weil ich weiß, wie hart es für viele Kinder heute noch ist, ihre Familienangehörigen zu pflegen. Die Situation in Pflegeheimen ist oft katastrophal, von staatlicher Seite kommt keine Hilfe, und die betreuenden Menschen sind hoffnungslos unterbezahlt. Es gibt einen Pflegenotstand. Das ist empörend und hat mich sehr berührt. Weil es nach wie vor so aktuell ist.
Der Pflegenotstand ist auch in Österreich ein großes Thema, und das seit Jahren. Woran liegt es Ihrer Ansicht, dass bei diesem Problem keine Verbesserung in Sicht ist?
Ich glaube, dass viele Menschen dazu neigen, das Thema Alter in der Gesellschaft weit von sich wegzuschieben. Sie wollen damit nicht belastet werden, befassen sich erst damit, wenn sie selbst alt sind. Die Folge ist, dass auch die Verantwortlichen es vermeiden, sich Gedanken zu machen. Aber man kann den Pflegenotstand eigentlich nicht erklären, er ist einfach nur ein Skandal.
Sie haben Ihren demenzkranken Vater selbst gepflegt, waren damals zwischen acht und fünfzehn Jahre alt. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?
Ich bin dieser Zeit im Nachhinein tatsächlich dankbar. Sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Es waren zwar ziemlich harte Jahre, aber ich habe dabei auch gelernt, zu überleben. Und dieser Überlebenstrieb hat mir in meinem Beruf später viel geholfen, weil es da wichtig ist, durchzuhalten, Enttäuschungen durchzustehen und nach vorne zu schauen. So bin ich erzogen worden: Probleme lösen sich nicht von selbst, man muss schon anpacken. Diese Einstellung verdanke ich der Zeit, als ich meinen Vater gepflegt habe.
Ich bin eher dafür, eine Beziehung zu retten – auch, weil ich von vielen Menschen, die sich getrennt haben, weiß, dass es danach nicht unbedingt besser wird.
Ängstigt Sie selbst der Gedanke ans Älterwerden?
Nein. Ich verbiete mir den Gedanken, darüber nachzudenken, was mich im Alter Schlimmes erwarten könnte. Was ich sagen kann, ist: Durch die Zeit mit meinen Eltern und die Erfahrungen mit dieser Krankheit, weiß ich das Leben mehr zu schätzen. Es hat meinen Blick auf das Leben geschärft. Ich habe gelernt, dass in kürzester Zeit alles kippen kann. Man muss dankbar sein für jeden Tag, den man gesund ist und erleben darf.
Sie sind Mutter von zwei Söhnen. Welchen Einfluss hatten Ihre Erfahrungen darauf, Ihre eigenen Kinder zu erziehen?
Mein Mann und ich haben versucht, mit meinen Söhnen immer über alles zu sprechen. Das ist mir schwergefallen, weil ich das Schweigen meiner Mutter in den ersten Jahren tatsächlich übernommen und dichtgemacht habe, wenn ich mich etwa gekränkt gefühlt habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich es heute schaffe, darüber zu sprechen, was mich stört oder was ich vermisse.
Die Kinder geben es zurück?
Ich glaube, wir konnten unsere Gesprächsbereitschaft sehr gut an unsere Buben weitergeben. Sie gehen sehr gut durchs Leben, sind rücksichtsvoll und offen. Das ist für mich das größte Geschenk, weil es mich viel Kraft gekostet hat, das Schweigen zu überwinden und wieder zurück ins Leben zu finden. Ich bin sehr froh, dass meine Söhne das von klein auf anders erlebt haben als ich.
Für die Mutter im Buch ist Biarritz der große Sehnsuchtsort. Was ist Ihrer?
Andalusien. Wenn wir wegfahren, dann dorthin. Ein kleines Dorf, sehr einsam, dort sind wir dann mit der ganzen Familie und unseren spanischen Freunden. Mein zweiter Sehnsuchtsort ist Rumänien. So oft es mir möglich ist, fahre ich hin und rette mithilfe einer Tierschutzorganisation Hunde aus den Tötungsstationen.
Für manche ist der Sehnsuchtsort ein Zelt oder Wohnmobil. Sie merken, wir wagen jetzt einen Richtungswechsel im Gespräch und reden über Ihre neue ZDF-Komödie „Familie Bundschuh: Wir machen Camping“. Wäre das etwas für Sie?
Nein. Obwohl ich eine sehr schöne Erinnerung daran habe: Nach dem Tod meines Vaters, ich war damals 16, mietete meine Mutter einen Campingwagen an der Atlantikküste, den wir bezogen haben. Das waren sehr schöne drei Wochen. Trotzdem habe ich das danach nie wieder gemacht. Obwohl ich die Idee des Campens nachvollziehen kann, die Freiheit und Unabhängigkeit.
Es ist der neunte Film der beliebten Filmreihe. Sie spielen Gundula, deren Ehe jetzt auf dem Prüfstand steht. Sie überlegt, ob sie ihren Gatten verlassen soll. Wie denken Sie darüber: eine zerrüttete Beziehung retten oder doch lieber ein Neubeginn?
Ich bin eher dafür, eine Beziehung zu retten – auch, weil ich von vielen Menschen, die sich getrennt haben, weiß, dass es danach nicht unbedingt besser wird. Ich kenne viele Frauen in meinem Alter, die den Absprung geschafft haben und dann aber feststellen mussten, dass sie eben alleine sind und eher niemanden mehr finden. Manche sind glücklich darüber, andere traurig.
Der Neuanfang, eine Sackgasse?
Wenn man sich gar nicht mehr schätzt und liebt und auch der Respekt voreinander verloren gegangen ist, ist eine Trennung schon besser. Bevor man sich gegenseitig zermürbt und gegenseitig auch noch den letzten Rest Stolz nimmt. Das ist fatal.
Glauben Sie an Paartherapie?
Ich habe keine Erfahrungen damit. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man sich auf ein geführtes Gespräch mit einer dritten Person einlässt. Auf eine Auseinandersetzung, bei der man sich wirklich aussprechen kann, ohne dass es beleidigend wird oder es mit den Türen knallt.
Die Bundschuhs wagen einen romantischen Kurzurlaub, um ihre Beziehung zu reparieren. Ein guter Tipp? Im Urlaub verbringt man mehr und intensiver Zeit miteinander, als vielleicht gewohnt.
Angeblich steigt die Trennungsrate nach Urlauben oder nach Weihnachten. Aber grundsätzlich halte ich eine Auszeit vom Alltag ab und zu für wichtig. Das ist natürlich immer auch eine Frage der wirtschaftlichen Möglichkeiten, das können sich nicht alle leisten und das ist ungerecht.
Sie sind bekanntlich mit Christian Berkel verheiratet, wie sie ist er Schauspieler und Autor. Ist das eher praktisch oder schwierig?
Es erleichtert vieles, weil wir uns nicht erklären müssen, wie unsere Berufe funktionieren. Wir wissen beide, wann es besser ist zu schweigen oder wann man sich das Recht vorbehält, sich in einen Freiraum zurückzuziehen. Dazu kommt: Wir arbeiten einfach sehr gerne miteinander. Wir spielen in unserer „Anfänger“-Reihe für die Degeto, betreiben eine Produktionsgesellschaft, und aktuell planen wir die Verfilmung meines Romans „Brunnenstraße“. Wir verstehen einander und das ist schon toll.



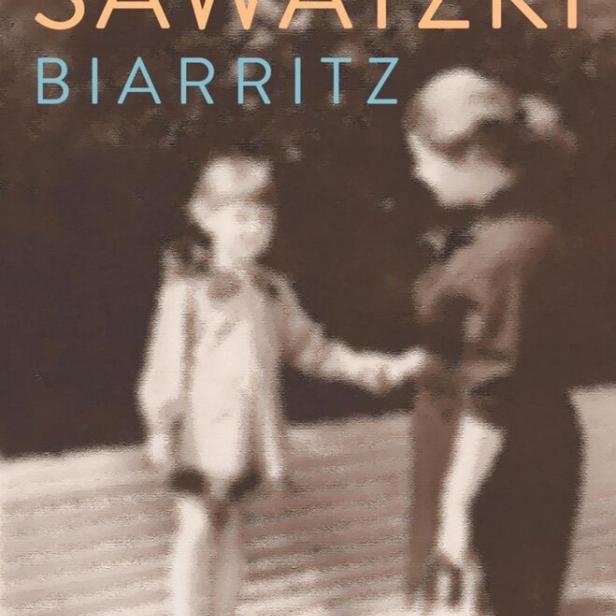




Kommentare